kündigungsschutz
Kündigungsschutz: Die 5 wichtigsten Fakten, die Sie kennen sollten!
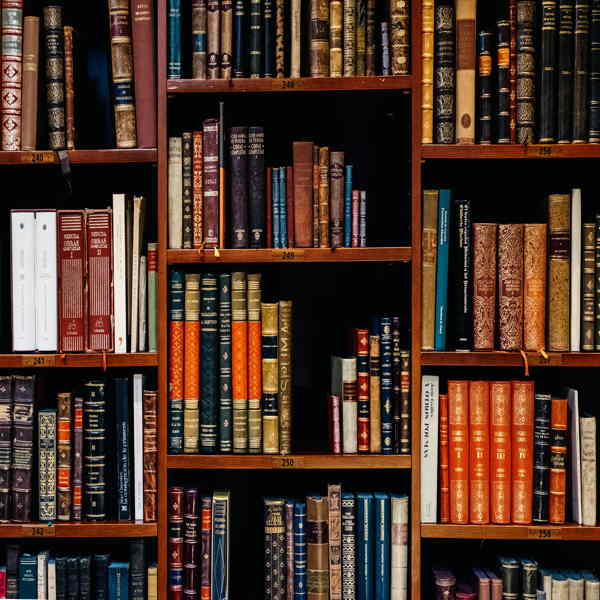
Der Kündigungsschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsrechts in Deutschland. Arbeitnehmer haben Anspruch auf Schutz vor sachfremden Kündigungen durch den Arbeitgeber. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) regelt die Bedingungen und Voraussetzungen für eine rechtmäßige Kündigung nach dem allgemeinen Kündigungsschutz. Daneben gibt es auch noch den besonderen Kündigungsschutz (z.B. für schwangere Arbeitnehmerinnen) und sog. Mindestkündigungsschutz. Hier eine Übersicht.
1. Einleitung: Warum Kündigungsschutz wichtig ist
Der Kündigungsschutz ist ein wichtiges Thema für Arbeitnehmer, da so ein gewisser Schutz vor einer einseitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber besteht. .Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) regelt die Voraussetzungen für den allgemeinen Kündigungsschutz. Dieser Kündigungsschutz schütz vor einer ordentlichen Kündigung des Arbeitgebers ohne soziale Rechtfertigung und ausreichenden Kündigungsgrund. Danach müssen Arbeitgeber bei einer ordentlichen Kündigung bestimmte Regeln beachten und nur unter Beachtung ist eine Kündigung dann wirksam. Der allgemeine Kündigungsschutz gilt für alle Arbeitnehmer und setzt voraus, dass das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate besteht und mehr als 10 Arbeitnehmer in Vollzeit im Betrieb beschäftigt sind.
2. allgemeiner Kündigungsschutz – Voraussetzungen
Der allgemeine Kündigungsschutz ist der häufigste Schutzmechanismus für Arbeitnehmer. Eine Vielzahl der Arbeitsverhältnisse fallen darunter. Die Voraussetzungen sind dabei nicht für den Betrieb insgesamt, sondern immer für jedes einzelne Arbeitsverhältnis zu prüfen.
Der allgemeine Kündigungsschutz gilt für alle Arbeitnehmer, die in einem Betrieb mit mehr als zehn in Volllzeit-Beschäftigten abzüglich der Auszubildenden arbeiten und bereits länger als sechs Monate im Betrieb tätig sind.
Nach dem Kündigungsschutzgesetz gibt es drei verschiedene Arten von Kündigungen. Genau genommen handelt es sich dabei um drei verschiedene Kündigungsgründe. Diese Gründe beziehen sich immer auf eine ordentliche Kündigung des Arbeitgebers. Für eine außerordentliche Kündigung gelten nach § 626 BGB besondere Regelungen.
Wenn das Kündigungsschutzgesetz auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet, kann der Arbeitgeber nur aus betriebsbedingten Gründen, personenbedingten Gründen oder verhaltensbedingten Gründen das Arbeitsverhältnis ordentlich mittels Kündigung gegenüber dem Arbeitnehmer beenden.
In einem Kündigungsschutzprozess muss der Arbeitgeber diese Voraussetzungen darlegen und notfalls beweisen. Dies ist fast immer recht schwierig. Oft sind Kündigungen, die von Arbeitgeberseite ausgesprochen werden und welche auf das Kündigungsschutzgesetz beruhen, unwirksam.
Wichtig ist aber zu wissen, dass die Unwirksamkeit immer gerichtlich festgestellt werden muss. Erhebt der Arbeitnehmer keine Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen nach dem Zugang der Kündigung, wird diese gemäß § 7 des Kündigungsschutzgesetzes wirksam. Dies ist die sogenannte Wirksamkeitsfiktion.
3. besonderer Kündigungsschutz – Voraussetzungen
Im Arbeitsrecht gibt es verschiedene Arten von Kündigungsschutz, die Arbeitnehmern je nach Situation zugutekommen können. Neben dem allgemeinen und dem Mindestkündigungsschutz gibt es auch einen besonderen Kündigungsschutz. Die Voraussetzungen dafür sind in verschiedenen Gesetzen festgelegt und hängen oft mit bestimmten Eigenschaften / Tätigkeiten des Arbeitnehmers zusammen, wie zum Beispiel einer Schwangerschaft oder einer Schwerbehinderung. Der Sonderkündigungsschutz ist stark personenbezogen.
Folgende Arbeitnehmer (keine abschließende Aufzählung) genießen besonderen Kündigungsschutz:
- Schwangere
- Personen in Elternzeit
- Mütter kurz nach der Geburt
- Betriebsräte
- Schwerbehinderte ab einen Grad der Behinderung von 50
- den schwerbehinderten Personen gleichgestellte Personen
- Personen, die sich in Pflegezeit befinden
- Personen, die sich in Familienpflegezeit befinden
Wichtig ist auch hier, dass unbedingt eine Kündigungsschutzklage erhoben werden muss, ansonsten wird auch hier – von Ausnahmen abgesehen – innerhalb von 3 Wochen die Kündigung wirksam.
4. Mindestkündigungsschutz- Voraussetzungen
Der Mindestkündigungsschutz ist der schwächste Kündigungsschutz. Diesen gibt es nur für sittenwidriger und treuwidrig Kündigung. Solche Kündigung kommen in der Praxis selten vor. Auch besteht hier die Besonderheit, dass der Arbeitnehmer die Voraussetzungen des Mindestkündigungsschutzes vor dem Arbeitsgericht nachweisen und notfalls beweisen muss.
Innerhalb dieser Fallgruppe sind am häufigsten die Fälle, bei denen durch die Kündigung eine Diskriminierung des Arbeitnehmers, zum Beispiel aufgrund seines Geschlechts oder Religion, erfolgt.
Darüber hinaus sind innerhalb dieser Fallgruppe auch Kündigungen recht häufig-obwohl diese genau genommen nicht zumindest Mindestkündigungsschutz zählen, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, so zum Beispiel gegen das Maßregelungsverbot.
Das Maßregelungsverbot (§ 612 a BGB) verbietet eine Kündigung, die aufgrund einer rechtsmissbräuchlichen oder sachfremden Motivation des Arbeitgebers erfolgt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Mitarbeiter sich gegenüber dem Arbeitgeber für seine Rechte eingesetzt hat und daraufhin gekündigt wird.
Ein klassischer Fall, den das Arbeitsgericht Berlin bereits entschieden hat, ist der, dass der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber rügt, dass er den gesetzlichen Mindestlohn nicht erhält und daraufhin der Arbeitgeber sofort das Arbeitsverhältnis mittels Kündigung beendet. Hier nimmt der Arbeitnehmer seine Rechte wahr und der Arbeitgeber verhält sich treuwidrig, da er den Arbeitnehmer dafür bestraft, dass dieser sich für seine Rechte einsetzt. Eine solche Kündigung ist unwirksam.
Aber der Arbeitnehmer muss hier Kündigungsschutzklage einreichen und auch nachweisen, dass letztendlich die Kündigung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung seiner Rechte steht. In der Regel wird man dann davon ausgehen, wenn zwischen der Wahrnehmung der Rechte, also hier die Forderung nach Zahlung des Mindestlohnes, und der Kündigung, ein sehr geringer Zeitraum besteht.
FAQ
Wann hat man einen Kündigungsschutz?
Kündigungsschutz – also den Schutz vor einer ordentlichen Kündigung des Arbeitgebers – haben alle Arbeitnehmer, auf die das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Darüber hinaus haben auch besondere Personengruppen, wie Schwangere, Schwerbehinderte, Betriebsräte etc. einen besonderen Kündigungsschutz. In seltenen Fällen kann auch ein Mindestkündigungsschutz außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes bestehen.
Wie lange hat ein Arbeitnehmer Kündigungsschutz?
Der allgemeine Schutz ist zeitlich unbegrenzt, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen. Dies kann sich aber ändern, wenn der Arbeitgeber irgendwann nicht mehr als 10 Arbeitnehmer in Vollzeit beschäftigt. Der Sonderkündigungsschutz ist häufig zeitlich begrenzt, z.B. bei einer Schwangeren oder Personen, die sich in Elternzeit befinden.
Wer hat alles einen Kündigungsschutz?
Ein Arbeitnehmer hat in Deutschland allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Dieser Schutz gilt jedoch nicht für alle Arbeitnehmer, sondern nur für solche, die in einem Betrieb beschäftigt sind, der regelmäßig mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt und bereits seit mindestens sechs Monaten im Unternehmen tätig sind. Besondere Personengruppen haben einen Sonderkündigungsschutz und in wenigen Fällen kann auch ein sog. Mindestkündigungsschutz vor einer Kündigung des Arbeitgebers schützen.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin Marzahn-Hellersdorf
Verbundkündigung-was ist das?

Was ist eine Verbundkündigung?
Eine Verbundkündigung besteht oft aus einer außerordentlichen, und einer hilfsweise ordentlichen Kündigung.
außerordentliche Kündigung
Oft ist es so, dass der Arbeitgeber meint einen außerordentlichen Kündigungsgrund zu haben und das Arbeitsverhältnis des kündigen möchte. In einem solchen Fall besteht aber die Gefahr für den Arbeitgeber, dass später das Arbeitsgericht diese außerordentliche Kündigung für unwirksam hält und dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber den Lohn bis zur Entscheidung im Kündigungsschutzverfahren nachzahlen muss. Man spricht hier vom sogenannten Annahmeverzugslohn. Dies ist für den Arbeitgeber ein großes Risiko, da eine außerordentliche Kündigung in der Praxis schwierig durchzusetzen ist. Der Arbeitgeber braucht einen wichtigen Grund, der es ihm unzumutbar macht das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer fortzusetzen und sogar unzumutbar noch bis Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zu warten.
Kündigungserklärungsfrist
Darüber hinaus muss der Arbeitgeber auch eine Erklärungsfrist nach § 626 Abs. 2 BGB beachten. D. h., dass der Arbeitgeber innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis vom wichtigen Grund, der zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, die Kündigung dem Arbeitnehmer auch aussprechen muss. Dies ist eine recht kurze Frist und wird in der Praxis nicht selten versäumt, was dazu führt, dass die außerordentliche Kündigung dann unwirksam ist.
Verbundkündigung und Prozessrisiko
Durch eine Verbundkündigung kann der Arbeitgeber das Risiko im Kündigungsschutzverfahren vermindern. Dadurch, dass er hilfsweise das Arbeitsfeld des auch ordentlich kündigt kündigt er unter einer innerprozessualen, zulässigen Bedingung, dass die außerordentliche Kündigung unwirksam ist. Der Arbeitgeber hat also faktisch zwei „Schüsse in der Flinte“. Wenn die erste außerordentliche Kündigung nicht greift, dann kann es sein, dass die ordentliche Kündigung, die er hilfsweise erklärt wird, das Arbeitsfeld ist doch noch beendet. Dann allerdings innerhalb der gesetzlichen bzw. arbeitsvertraglichen oder tarifvertraglichen Kündigungsfrist.
Kündigungsschutzklage
Das Arbeitsgericht überprüft dann zunächst-wenn der Arbeitnehmer rechtzeitig Kündigungsschutzklage gegen die Kündigungen einreicht-die Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung und wenn das Arbeitsgericht der Meinung ist, dass diese unwirksam ist, beschäftigt sich das Arbeitsverhältnis des mit der hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung. Wenn beide Kündigung unwirksam sind, dann wird das Arbeitsgericht feststellen, dass das Arbeitsverhältnis weder durch die außerordentliche noch durch die ordentliche Kündigung des Arbeitgebers aufgelöst worden ist.
Es kann aber auch sein, dass das Gericht der Meinung ist, dass die ordentliche Kündigung das Arbeitsverhältnis des beendet hat und dann endet das Arbeitsverhältnis durch die ordentliche Kündigung nach der entsprechenden Kündigungsfrist.
Fehler durch den Arbeitnehmer
Auch der Arbeitnehmer kann hier Fehler machen und zwar den Fehler, dass er nur von einer einzigen Kündigung ausgeht und dann sich gegen „die Kündigung des Arbeitgebers“ wehrt. Dies ist falsch, denn eine Verbundkündigung besteht aus wenigstens zwei Kündigungen. Der Arbeitnehmer muss also Kündigungsschutzklage einreichen sowohl gegen die außerordentliche als auch gegen die hilfsweise ordentliche Kündigung des Arbeitgebers. Die Arbeitsgerichte sind aber recht großzügig bei der Auslegung der Kündigungsschutzanträge, zumindest dann, wenn diese von juristischen Laien gefertigt werden.
Was passiert, wenn der Arbeitnehmer nicht klagt?
Wenn der Arbeitnehmer nicht gegen die Kündigungen klagt, dann wird die Folge nach § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ein. Danach wird das Arbeitsverhältnis als wirksam beendet angesehen und zwar durch die erste Kündigung und in diesem Fall ist dies die außerordentliche Kündigung. Für den Arbeitnehmer ist dies ein möglichst schlechter Fall, da eine Sperre von Agentur für Arbeit dann recht sicher ist.
Was passiert, wenn der Arbeitnehmer das Verfahren gewinnt?
Wenn der Arbeitnehmer gegen beide Kündigung klagt und das Kündigungsschutzverfahren gewinnt, dann stellt das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die beiden Kündigungen (Verbundkündigung) aufgelöst worden ist. Der Arbeitnehmer kann noch ein Weiterbeschäftigungsantrag stellen und dann würde das Arbeitsgericht den Arbeitgeber verpflichten den Arbeitnehmer über das Kündigungsende hinaus weiter zu beschäftigen.
Kann auch der Arbeitnehmer eine Verbundkündigung aussprechen?
Auch der Arbeitnehmer kann grundsätzlich eine Verbundkündigung aussprechen und dies bietet sich auf jeden Fall auch dann an, wenn der Arbeitnehmer nicht sicher ist, dass die außerordentliche Kündigung tatsächlich greift. Dies sollte man fast für jeden Fall annehmen, da man fast nie sicher sein kann, dass tatsächlich ein wichtiger Kündigungsgrund vorliegt und auch vor dem Gericht nachgewiesen werden kann. Von daher bietet sich fast immer an, wenn der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis ist aus wichtigem Grund kündigen möchte, dass er hilfsweise auch ordentlich kündigt. Einen Kündigungsgrund für die hilfsweise ordentliche Kündigung braucht der Arbeitnehmer-im Gegensatz zum Arbeitgeber, bei dem das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet-nicht.
Fazit: Die Verbundkündigung spielt in der Praxis eine große Rolle und sollte in der Regel sowohl von Arbeitgeberseite als auch von Arbeitnehmerseite eingesetzt werden.
Mehr Informationen finden Sie auch auf meinen Podcast zum Thema „Was ist eine Verbundkündigung?“.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Azubi lässt sich krank schreiben und trainiert dann im Fitnessstudio – fristlose Kündigung wirksam

Kündigungsschutz im Ausbildungsverhältnis
Auszubildende werden rechtlich manchmal besser gestellt als Arbeitnehmer, zumindest, wenn es um die ordentliche Kündigung durch den Ausbilder geht. Nach der Wartezeit kann der Arbeitgeber ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr mit ordentlicher Kündigung beenden, sondern nur noch mit einer außerordentlichen Kündigung (§ 22 Berufsbildungsgesetz – BBiG).
hohe Anforderungen an Gründe für außerordentliche Kündigung eines Auszubildenden
Die Anforderung an eine solche außerordentliche Kündigung sind recht hoch. Es muss immer ein wichtiger Grund gem. § 626 BGB / § 22 BBiG vorliegen. Dies wird oft von Arbeitgeberseite in der Praxis unterschätzt. Nur selten liegen entsprechende Gründe tatsächlich vor.
§ 22 BBiG lautet:
§ 22 Kündigung
(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
1.
aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
2.
von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen.
(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.
wichtiger Grund und Kündigung eines Azubis
Ob ein wichtiger Grund für die Kündigung des Arbeitgebers gegeben ist, haben die Gerichte nach einem objektiven Maßstab zu beurteilen. Das Arbeitsgericht muss prüfen, ob die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers / Auszubildenden bei objektiver Beurteilung zu bejahen ist und schon im Zeitpunkt der Kündigung gegeben war. Die außerordentliche Kündigung kann dabei auf alle Gründe gestützt werden, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung objektiv vorlagen.
fristlose Kündigung beim Vortäuschen einer Erkrankung
Außerordentliche Kündigungen wegen einer vorgetäuschten Erkrankung kommen in der Praxis häufig vor, werden aber oft den Arbeitsgerichten für unwirksam erklärt. Der Arbeitgeber muss hier die fehlenden Erkrankung / Täuschung nachweisen, was schwierig ist, denn eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat einen gewissen Beweiswert. Dieser kann aber auch entkräftet werden, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer selbst kündigt und eine „passende“ AU-Bescheinigung bis zum Ende des Arbeitsverhältnis gleichzeitig vorlegt.
Arbeiten während der Krankschreibung
Auch das Nachgehen einer anderen Tätigkeit während der Zeiten der arbeitsunfähigen Erkrankung kann problematisch sein (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 03.04.2008 – 2 AZR 965/06). Ausnahmsweise ist diese aber zulässig, wenn der Heilungsprozess nicht verzögert wird.
Entscheidung des Arbeitsgerichts Siegburg zur fristlosen Kündigung
Das Arbeitsgericht Siegburg (Urteil vom 17.3.2022 – 5 Ca 1849/21) hatte sich nun mit einem ähnlichen Fall zu beschäftigen. Ein Arbeitgeber/Ausbilder hatte einem Auszubildenden das Ausbildungsverhältnis außerordentlich und fristlos gekündigt.
Dieser hatte sich arbeitsunfähig schreiben lassen, obwohl er gar nicht erkrankt war. Zumindest schloss der Arbeitgeber/Ausbilder aufgrund des Verhaltens des Azubis, dass keine Arbeitsunfähigkeit vorgelegen haben konnte. Von daher ging der Arbeitgeber/Ausbilder davon aus, dass hier eine unberechtigte Krankschreibung vorgelegen hat und der Auszubildende den Arbeitgeber über seine Erkrankung/Arbeitsunfähigkeit getäuscht hat.
Folgender Fall lag dem zugrunde.
Ein 24-jährige Azubi machte beim Ausbilder eine Lehre zum Sport- und Gesundheitstrainer in einem Fitnessstudio. Ganz so clever war der Auszubildende aber nicht, denn er fiel bei einer schulischen Prüfung durch. Wahrscheinlich hatte dieser auch für die Nachholprüfung, welche für den 5./6.10.2021 angesetzt war, nicht ausreichend gelernt, denn er ließ sich für diesen Zeitraum krank schreiben. Der Azubi erschien dazu am 6.10.2021 im Fitnessstudio der Beklagten und legte für den Zeitraum 5.-7.10.2021 eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor und absolvierte sodann ein intensives Krafttraining. An der Nachprüfung in der Berufsschule nahm der Azubi wegen seiner „Erkrankung“ nicht teil. Der Kläger erhielt am 6.10.2021 deswegen eine fristlose Kündigung. Hiergegen richtet sich seine Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht.
Kündigungsschutzklage ohne Erfolg
Das Arbeitsgericht Siegburg hat die Kündigungsschutzklage des Auszubildenden abgewiesen und ist davon ausgegangen, dass die fristlose Kündigung zu Recht erteilt wurde. Insbesondere hat das Arbeitsgericht auch offengelassen, ob der Auszubildende eine Gefälligkeitsbescheinigung vom Arzt erhalten hat oder ob er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arzt erschlichen (Täuschung des Arztes) hat. Für das Gericht war klar, dass eine Erkrankung nicht vorgelegen haben konnte (Krafttraining), sondern diese vorgeschoben war, um die Nachprüfung zu umgehen.
Eine Weiterbeschäftigung des Klägers bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist war dem Arbeitgeber / Ausbilder hier nicht zuzumuten. Nach dem Arbeitsgericht darf kein Auszubildender darf davon ausgehen, dass dessen Ausbilder es hinnimmt, falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorgelegt zu bekommen, um sich den anstehenden Prüfungen, insbesondere wenn es sich um Nachholprüfungen handelt, zu entziehen.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fristlose Kündigung eines Betriebsrats wegen Veröffentlichung persönlicher Daten anderer Arbeitnehmer

Betriebsräte genießen einen besonderen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Geregelt ist dieser Sonderkündigungsschutz in § 15 des Kündigungsschutzgesetzes. Allerdings schützt dieser Kündigungsschutz nur vor einer ordentlichen Kündigung des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber einen außerordentlichen Kündigungsgrund hat, dann kann er auch das Arbeitsverhältnis eines Betriebsrates durch fristlose Kündigung beenden. In der Praxis kommt es eher nicht so häufig vor, dass ein wichtiger Grund gemäß § 626 Abs. 1 BGB vorliegt, sodass der Arbeitgeber außerordentlich aus wichtigem Grund das Arbeitsverhältnis eines Betriebsrates kündigen kann.
außerordentliche Kündigung und Betriebsrat
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hatte nun über einen solchen Fall zu entscheiden.
Sachverhalt des Landesarbeitsgerichts
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Zwischen dem Arbeitnehmer, der Betriebsrat war, und dem Arbeitgeber gab es ein Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht. Noch vor Rechtskraft der Entscheidung veröffentlichte der Betriebsrat die Prozessakten zu seinem Fall über eine Dropbox und gab so anderen Mitarbeitern die Möglichkeit dieser einzusehen. In den Prozessakten wurden persönliche Daten anderer Arbeitnehmer, insbesondere auch Gesundheitsdaten unter Nennung des vollen Namens, veröffentlicht.
fristlose Kündigung wegen Verletzung des Datenschutzes
Als der Arbeitgeber davon erfuhr, kündigte er außerordentlich und fristlos das Arbeitsverhältnis des Betriebsrats.
Der Betriebsrat wehrte sich gegen diese außerordentliche Kündigung mittels einer Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht.
Datenschutz im Arbeitsverhältnis
Der Betriebsrat argumentierte vor dem Arbeitsgericht, dass die Kündigung unwirksam ist. Nach Meinung des Betriebsrats bestehe keine Vorschrift, die es gebiete, Prozessakten geheim zu halten, im Übrigen sei ein Datenschutzverstoß schon deshalb abzulehnen, da er mit Blick auf Art. 2 Abs. 2c DS-GVO ausschließlich im Rahmen „persönlicher oder familiärer Tätigkeiten“ gehandelt habe.
Der als Betriebsrat tätige Arbeitnehmer verlor das Verfahren vor dem Arbeitsgericht und legte Berufung zum LAG ein.
Entscheidung des Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
Das LAG Baden-Württemberg (Urteil vom 25.03.2022, 7 Sa 63/21) entschied gegen den Arbeitnehmer.
In der Pressemitteilung vom 25. März 2022 führte das Landesarbeitsgericht dazu aus:
Wer im Rahmen eines von ihm angestrengten Gerichtsverfahrens bestimmte Schriftsätze der Gegenseite, in denen Daten, insbesondere auch besondere Kategorien personenbezogener Daten (Gesundheitsdaten), verarbeitet werden, der Betriebsöffentlichkeit durch die Verwen- dung eines zur Verfügung gestellten Links offenlegt und dadurch auch die Weiterverbreitungs- möglichkeit eröffnet, ohne dafür einen rechtfertigenden Grund zu haben, verletzt rechtswidrig und schuldhaft Persönlichkeitsrechte der in diesen Schriftsätzen namentlich benannten Perso- nen mit der Folge, dass vorliegend die außerordentliche Kündigung der Beklagten gerechtfer- tigt ist. Die Wahrnehmung berechtigter Interessen des Klägers lag jedenfalls insofern nicht vor, als die Entscheidungsgründe des Urteils des Arbeitsgerichts am Tage der Zurverfügungstel- lung des Links noch nicht vorlagen und dem Kläger auch noch die Möglichkeit offenstand, ge- gen das Urteil das Rechtsmittel der Berufung einzulegen, um in diesem Verfahren seinen Standpunkt darzulegen.
LAG BW Urteil vom 25.03.2022, 7 Sa 63/21
Anmerkung:
Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts erscheint hier recht hart. Es ist aber zu beachten, dass der Arbeitnehmer hier ohne nachvollziehbaren Grund-das Arbeitsgerichtsverfahren war noch nicht einmal rechtskräftig-die Schriftsätze veröffentlicht hat und in diesen Schriftsätzen die Gesundheitsdaten mehrerer anderer Arbeitnehmer, die nichts mit dem Verfahren zu tun haben, veröffentlicht waren. Gerade die Sensibilität dieser Daten war der Grund für die harte Entscheidung des Landesarbeitsgerichts.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kündigung durch Arbeitgeber – was tun?

Kündigung durch den Arbeitgeber
Die Kündigung (ordentlich oder außerordentlich) durch den Arbeitgeber, egal ob aus betriebsbedingten, verhaltensbedingten oder personenbedingten Gründen, ist für den Arbeitnehmer eine einschneidende Maßnahme. Der Arbeitnehmer möchte wissen, wie er sich effektiv gegen die Kündigung wehren kann und ob er gute Chancen hat auf Weiterbeschäftigung oder Zahlung eine Abfindung.
Das Wichtigste vorab:
Anbei die wichtigsten Informationen zur Arbeitgeberkündigung vorab:
Arbeitgeber braucht einen Kündigungsgrund
> Bei der ordentlichen Kündigung braucht der Arbeitgeber im Normalfall einen Kündigungsgrund. Nur im Kleinbetrieb oder in der Wartezeit ist ein Grund für die Arbeitgeberkündigung entbehrlich.
Bei der fristlosen Kündigung muss der Arbeitgeber immer einen Kündigungsgrund haben, also auch in der Wartezeit/ Probezeit und im Kleinbetrieb.
allgemeiner Kündigungsschutz
> Nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit bei einem Betrieb von mehr als zehn Arbeitnehmer in Vollzeit besteht ein allgemeiner Kündigungsschutz, der den Arbeitnehmer vor einer willkürlichen Kündigung schützt. Der Arbeitgeber braucht dann definitiv einen Kündigungsgrund.
Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz
> Wenn allgemeinen Kündigungsschutz besteht nach dem Kündigungsschutzgesetz, kann der Arbeitgeber nur personenbedingt aus betrieblichen Gründen oder verhaltensbedingt das Arbeitsverhältnis kündigen.
Sonderkündigungsschutz
> Darüberhinaus kann für besondere Personengruppen, wie zum Beispiel Schwangere, Behinderte, Betriebsräte, Datenschutzbeauftragte ein sogenannter Sonderkündigungsschutz (besonderer Kündigungsschutz) bestehen. Diesen besonderen Kündigungsschutz findet man nicht im Kündigungsschutzgesetz, sondern in arbeitsrechtlichen Spezialgesetzen.
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen im Arbeitsrecht durch den Arbeitgeber
> Der Arbeitgeber muss bei einer regulären Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Kündigungsfristen einhalten und zwar entweder die gesetzlichen (§ 622 BGB) oder- falls ein Tarifvertrag Anwendung findet-die tarifvertraglichen Kündigungsfristen. Besondere Fristen können sich vor allen aus Tarifverträgen ergeben. Der Arbeitnehmer kann – bei fehlender anderweitiger Regelung – mit der gesetzlichen Frist von 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende kündigen. Von daher hat der Arbeitnehmer in der Regel die kürzere Frist. Die längeren Fristen für den Arbeitgeber nach dem Gesetz ergeben sich ebenfalls nach § 622 BGB und sind abhängig von daher Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses.
Oft kündigen Arbeitgeber mit ordentlicher Frist, "hilfsweise zum nächstmöglichen Termin". Dies ist zulässig.
Tipp: Nach dem Erhalt einer Kündigungserklärung sollte sich der Arbeitnehmer umgehend beim Rechtsanwalt beraten lassen.
3-Wochenfrist beachten!
> Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage beträgt nur drei Wochen. Nach der Kündigung in Verhandlung mit dem Arbeitgeber über eine Abfindung zu treten, ist sinnlos und gefährlich. Oft wird dabei die Klagefrist versäumt.
Was tun bei Kündigung durch den Arbeitgeber?
Der Arbeitnehmer sollte folgendes machen:
- Ruhe bewahren und das Datum des Erhalts der Kündigung notieren
- Ab dem Zugangsdatum die Klagefrist von 3 Wochen notieren
- Rechtschutz für Arbeitsrecht anrufen und nachfragen, ob für diesen Fall sog. Deckungsschutz besteht
- Anwaltstermin vereinbaren, am besten beim Fachanwalt für Arbeitsrecht
- mit dem Anwalt das Ziel (Weiterbeschäftigung oder Abfindung oder anderes Ziel) besprechen und Klageauftrag erteilen
- der Anwalt setzt im Optimalfall das Ziel im Gütetermin oder durch Entscheidung des Gerichts durch (Achtung eine Abfindung kann man in der Regel nur aushandeln).
Welche Kündigungen gibt es?
Man unterscheidet zunächst zwischen einer ordentlichen und einer außerordentlichen Kündigung. Du hinaus kann man auch noch *bestimmte Kündigungsformen unterscheiden.
Arten von Kündigungen
| Art der Kündigung | Erklärung dazu |
|---|---|
| ordentliche | unter Einhaltung der Kündigungsfrist |
| außerordentliche | ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist |
| betriebsbedingte | Vorliegen von dringenden betrieblichen Erfordernissen |
| verhaltensbedingte | wegen eines Fehlverhaltens des Arbeitnehmers |
| personenbedingte | Gründe liegen in der Person des Arbeitnehmers |
| krankheitsbedingte | Unterfall der personenbedingten Kündigung |
| Änderungskündigung | und Änderungsangebot an Arbeitnehmer |
| fristgerechte | Einhaltung der Kündigungsfrist |
| fristlose | sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses |
| hilfsweise | Kündigung für den Fall, dass die vorherige nicht greift |
| Probezeitkündigung | in der Probezeit/ Wartezeit des Arbeitnehmers |
Was ist eine ordentliche Kündigung des Arbeitgebers?
Die ordentliche oder auch reguläre Kündigung ist der Normalfall der Kündigung. Der Arbeitgeber kündigt hier unter Einhaltung der Kündigungsfristen. In der Regel braucht der Arbeitgeber sachliche Gründe nach dem KSchG. Sofern kein allgemeiner Kündigungsschutz gilt, darf nicht völlig willkürlich gekündigt werden (Stichtwort: Mindestkündigungsschutz).
Was ist eine außerordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber?
Eine fristlose Kündigung** erfolgt aus einem wichtigen Grund. Nur wenn es dem Arbeitgeber nicht mehr zumutbar ist das Arbeitsverhältnis mit regulärer Frist zu kündigen, kann er beim Vorliegen eines außerordentlichen Grundes (§ 626 II BGB), das Arbeitsverhältnis auch außerordentlich und dann meist fristlos kündigen. Der Hauptanwendungsfall ist dabei die fristlose verhaltensbedingte Kündigung**. Eine Arbeitgeberkündigung aus einem außerordentlichen Grund muss nicht zwingend ohne Frist, also fristlos erfolgen. Hier kann der Arbeitnehmer oft Probleme mit der Agentur für Arbeit beim Arbeitslosengeld I bekommen. Eine Sperre beim Arbeitslosengeld ist hier – sofern die Beendigung des Arbeitsvertrags selbst verschuldet ist – wahrscheinlich. Sofern eine Sperre von der Agentur für Arbeit angeordnet wird, hilft oft nur die Einschaltung eines Anwalts.
Welche Gründe kann es für eine Arbeitgeberkündigung geben?
Wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann besteht allgemeiner Kündigungsschutz und der Arbeitgeber kündigt entweder aus personenbedingten, betriebsbedingten oder verhaltensbedingten Gründen. Dies ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt. Aus anderen Gründen kann er nicht ordentlich das Arbeitsverhältnis kündigen.
§ 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG > Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist.
Für welche Personengruppen besteht der besondere Kündigungsschutz?
Sonderkündigungsschutz besteht zum Beispiel:
| Sonderkündigungsschutz | gesetzliche Norm |
|---|---|
| während des Mutterschutzes | § 9 Abs. 1 MuSchG |
| während der Elternzeit | § 18 BEEG |
| während der Pflegezeit | § 5 PflegeZG |
| bei einer Schwerbehinderung | § 85 SGB IX |
| als Datenschutzbeauftragter | § 4f Abs. 3 S. 5 und 6 BDSG |
In welcher Form muss die Kündigung erfolgen?
Das Gesetz sieht für eine ausgesprochene Kündigung zwingend die Schriftform vor. Geregelt ist dies in § 623 des bürgerlichen Gesetzbuch. Eine andere Form als die Schriftform – also mündlich, per E-Mail oder per Fax oder WhatsApp ist nicht möglich und wäre damit nichtig.
Beispiel:
Arbeitnehmer A wird von Arbeitgeber B nach einem Streitgespräch mündlich gekündigt und nach Hause geschickt. Ergebnis: Die mündliche Kündigung nichtig.Der Arbeitnehmer A sollte seine Arbeitskraft unter Zeugen erneut anbieten.
§ 623 BGB > Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.
Formen der Kündigung und Formwirksamkeit
| Form der Kündigung | Wirksamkeit |
|---|---|
| schriftlich | formwirksam |
| per E-Mail | unwirksam und nichtig |
| per WhatsApp | unwirksam und nichtig |
| mündlich | unwirksam und nichtig |
| per Fax | unwirksam und nichtig |
| per Facebook | unwirksam und nichtig |
| per SMS | unwirksam und nichtig |
Muss der Arbeitgeber den Kündigungsgrund in der Kündigungserklärung angeben?
Nein, dies ist ein häufiges Missverständnis. Der Arbeitgeber muss in der Kündigungserklärung im Normalfall keinen Kündigungsgrund angeben. Oft meinen Arbeitnehmer, dass die Kündigung unwirksam ist, wenn kein Grund angegeben wurde. Das ist nicht der Fall. Nur in ganz wenigen Fällen, muss der Kündigungsgrund in der Kündigung mitgeteilt werden, wie zum Beispiel beim Auszubildenden nach der Probezeit muss ein Grund in der Kündigungserklärung angegeben werden.
Woher soll dann der Arbeitnehmer wissen, weshalb er gekündigt wurde?
Der Arbeitnehmer hat in bestimmten Fällen einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber in hinsichtlich des Kündigungsgrundes. Nur so kann er schon vor der arbeitsgerichtlichen Klage beurteilen, ob die schriftliche Kündigung wirksam ist oder nicht. Dies ist gesetzlich für die fristlose Kündigung geregelt in § 626 II BGB. Ansonsten ergibt sich ein solcher Anspruch aus Treu und Glauben. Unabhängig davon muss der Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess ja den Kündigungsgrund angeben darlegen und notfalls beweisen. D. h. spätestens in der Güteverhandlung erfährt der Arbeitnehmer, aus welchen Gründen der Arbeitgeber hier die Kündigung ausgesprochen hat.
Welche Kündigungsfristen gibt es für die ordentliche Kündigung?
Wenn es keine tarifvertraglichen Kündigungsfristen gibt, dann gelten die Kündigungsfristen im Arbeitsvertrag, falls diese wirksam sind. Ansonsten gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen, was in den meisten Fällen so ist. Diese muss der Arbeitgeber zwingend einhalten.
Wie lang sind die gesetzlichen Kündigungsfristen?
Die gesetzlichen Kündigungsfristen sind in § 622 BGB geregelt und lauten wie folgt:
Zusammenfassung der gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB
gesetzliche Kündigungsfristen für den Arbeitgeber:
| Dauer des Arbeitsverhältnisses | Kündigungsfrist |
|---|---|
| Probezeit | 2 Wochen |
| nach 6 Monaten | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende |
| nach 2 Jahren | 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 5 Jahren | 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 8 Jahren | 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 10 Jahren | 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 12 Jahren | 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 15 Jahren | 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| nach 20 Jahren | 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
Was ist bei betriebsbedingten Kündigungen zu beachten?
Eine betriebsbedingte Kündigung erfolgt wegen dringender betrieblicher Erfordernisse. Neben den dringenden betrieblichen Erfordernissen muss auch keine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung im Unternehmen des Arbeitnehmers bestehen. Dabei muss der Arbeitgeber prüfen, ob er den Arbeitnehmer auf einen anderen freien Arbeitsplatz im Unternehmen beschäftigen kann. Notfalls muss er hier eine gewisse Einarbeitungszeit einplanen, die im Normalfall sogar so lang sein kann, wie die Kündigungsfrist, die hier für die Kündigung zu beachten ist. Bei betriebsbedingten Kündigungen sind für die Arbeitgeberseite viele Hürden von den Arbeitsgerichten zu nehmen. Solche Kündigungsrechtsstreitigkeiten sind für Arbeitgeber nicht einfach zu führen.
Sozialauswahl
Weiter ist bei dieser Kündigungsform eine so genannte Sozialauswahl vorzunehmen. Der Arbeitgeber muss faktisch eine Auswahl unter den Arbeitnehmern treffen, deren Arbeitsplatz hier wegfällt und prüfen, welcher Arbeitnehmer am wenigsten schutzbedürftig ist. Dabei sind nur vergleichbare Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Die Sozialauswahl wird im Normalfall so getroffen, dass man das Lebensalter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit und bestehende Unterhaltspflichten bzw. Behinderungen der Arbeitnehmer gegeneinander abwägt.
Was ist eine verhaltensbedingte Kündigung?
Hier liegt ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers vor. Der Grund ist also das konkrete Verhalten bzw. ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers. Bei solchen verhaltensbedingten Kündigungen muss der Arbeitgeber im Rahmen der Verhältnismäßigkeit abschätzen, ob er das Verhalten gegebenfalls abmahnen kann, da die Abmahnung im Gegensatz zu Kündigung das mildere Mittel ist. Auf dieses mildere Mittel muss der Arbeitgeber zurückgreifen, wenn insbesondere kein sehr schwerer Vertrauensverstoß durch das Fehlverhalten des Arbeitnehmers herbeigeführt wurde und wenn ein steuerbares erstmaliges Verhalten des Arbeitnehmers vorliegt. Eine vorherige Abmahnung sollte der Normalfall sein. Der Arbeitgeber muss auch hier die gesetzlichen Vorgaben und die Vorgaben der Rechtsprechung beachten. Andererseits können schwere Vertrauensverstöße – wie zum Beispiel die massive sexuelle Belästigung einer Arbeitskollegin – auch ohne vorherige Abmahnung zur Beendigung des Arbeitsvertrags führen.
Was ist eine personenbedingte Kündigung?
Bei der personenbedingten ordentlichen Kündigung handelt es sich meist um eine Kündigung aus krankheitsbedingten Gründen. Dies muss aber nicht immer der Fall sein. Ein Verschulden des Arbeitnehmers liegt hier nicht vor. Die Kündigungserklärung basiert darauf, dass Gründe in der Person des Arbeitnehmers vorliegen, die den Arbeitgeber berechtigen und es dem Arbeitgeber nicht mehr zumutbar machen das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer weiterzuführen. Der Hauptfall ist die Kündigung wegen Krankheit. Die Kündigung wegen einer Krankheit des Arbeitnehmers kann man in zwei Fallgruppen Unterteilen und zwar zum einen aufgrund von häufigen Kurzerkrankungen oder einer Langzeiterkrankung des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber muss eine negative Prognose treffen. Nur eine negative Gesundheitsprognose berechtigt dazu das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer einseitig durch Gestaltungsrecht zu beenden.
An die krankheitsbedingte Kündigung sind hohe Anforderungen zu stellen. Der Arbeitnehmer muss also entweder sehr häufig oder sehr lange krank gewesen sein. In der Regel muss der Arbeitnehmer ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) zuvor durchführen. In diesen Fällen kommt es oft zu einer krankheitsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber :
- dauernde Arbeitsunfähigkeit bzw.
- lang andauernde Krankheit oder
- häufige Kurzerkrankungen
- Leistungsminderung aufgrund von Krankheit
Muss eine außerordentliche Kündigung immer fristlos erfolgen?
Außerordentlich heißt nicht immer fristlos. Außerordentlich besagt, was für ein Kündigungsgrund vorliegt und fristlos besagt, die Frist mit der gekündigt wird. Es sind Fälle denkbar, bei denen der Arbeitgeber außerordentlich aber nicht fristlos kündigt. Dies hört sich zunächst widersprüchlich an, allerdings ist es möglich, dass der Arbeitgeber zum Beispiel das Arbeitsverhältnis außerordentlich mit einer sozialen Auslauffrist kündigt.
Gibt es eine außerordentliche personenbedingte Kündigung?
Dies ist denkbar, wenn eine extreme Störung des Arbeitsverhältnisses vorliegt und es dem Arbeitgeber nicht mehr zumutbar ist den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. Denkbar ist zum Beispiel der Fall, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer als Kraftfahrer eingestellt hat und der Arbeitnehmer aufgrund einer außerdienstlichen Straftat seinen Führerschein für ein Jahr verliert. Wenn er den Arbeitnehmer tatsächlich nur als Fahrer beschäftigen kann und der Arbeitnehmer auch noch nicht so lange beim Arbeitgeber gearbeitet hat, dann ist hier denkbar dass der Arbeitgeber außerordentlich aus personenbedingten Gründen kündigt. Eine verhaltensbedingte Kündigung kann in solchen solchen Fällen auch denkbar sein, wenn zum Beispiel ein Fehlverhalten innerhalb der Arbeitszeit des Arbeitnehmers vorliegt, zum Beispiel Alkoholfahrt des Berufskraftfahrers.
Gibt es eine außerordentliche betriebsbedingte Kündigung?
Auch dies ist denkbar, aber in der Praxis kommt diese äußerst selten vor. Es muss dem Arbeitgeber schlichtweg unzumutbar sein, den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Kündigungsfrist aus betrieblichen Gründen zu beschäftigen, da der Arbeitsplatz des Arbeitnehmer faktisch sofort entfallen ist und er den Arbeitnehmer nicht mehr finanzieren kann. Auch wenn wahrscheinlich viele Arbeitgeber meinen, dass gerade dieser Fall bei ihnen vorliegt, kommt er doch in der Praxis äußerst selten vor und ist sehr schwierig durchzusetzen.
Was ist eine Änderungskündigung?
Eine Änderungskündigung ist eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses und ein Angebot des Arbeitnehmers zu neuen Arbeitsbedingungen nach Ablauf der Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Die Änderungskündigung besteht also aus einer Kündigung und einem Angebot. Der Arbeitnehmer hat hier 3 Möglichkeiten auf die Änderungskündigung zu reagieren.
Kann das Änderungsangebot schlichtweg ablehnen , dann endet der Arbeitsvertrag durch die Kündigung. Er kann hier aber auch Kündigungsschutzklage einreichen. Die Frist beginnt 3 Wochen ab Kenntnis (Zugang) der Änderungskündigung. Weiter kann der Arbeitnehmer das Angebot unter dem Vorbehalt annehmen und sodann eine Änderungschutzklage zum Arbeitsgericht erheben. Das Gericht entscheidet dann, ob der Arbeitnehmer zu den neuen oder zu den alten Arbeitsbedingungen das Arbeitsverhältnis fortsetzen kann. Weiter kann der Arbeitnehmer auch das Änderungsangebot annehmen, dann wird nach Ablauf der Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis zu den neuen Bedingungen fortgesetzt.
Übersicht der Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers bei einer Änderungskündigung
| Handlungsmöglichkeiten | Handlungen | Klage | Ergebnis nach Ablauf der Kündigungsfrist |
|---|---|---|---|
| Annahme | Erklärung innerhalb von 3 Wochen | keine Klage notwendig | Weiterarbeit zu geänderten Bedingungen |
| Ablehnung | Erklärung nicht notwendig | Kündigungsschutzklage möglich | Ende des Arbeitsverhältnisses |
| Annahme unter Vorbehalt | Erklärung innerhalb von 3 Wochen | Änderungsschutzklage notwendig | zunächst Weiterarbeit zu geänderten Bedingungen/ aber Änderung zu alten Arbeitsbedingungen bei Prozessgewinn |
Welche Fehler werden häufig bei der Kündigung von Arbeitgeberseite gemacht?
Häufig vorkommende Fehler von Arbeitgeber bei einer Kündigung sind hier kurz aufgelistet.
Häufige Fehler des Arbeitgebers sind:
- die Arbeitgeberkündigung wird per E-Mail, per WhatsApp oder per Fax ausgesprochen
- längere Fristen werden nicht beachtet oder im Arbeitsvertrag ist eine unwirksame Regelung zur Kündigungsfristen formuliert
- der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers fällt bei Kündigung aus betriebsbedingten Gründen gar nicht weg, sondern der Arbeitgeber hat dafür andere Gründe
- Ein freier Arbeitsplatz wird durch einen anderen, also nicht durch den gekündigten Arbeitnehmer besetzt
- die Sozialauswahl wird falsch durchgeführt
- der Betriebsrat wird nicht richtig informiert
- eine außerordentliche Kündigung wird nicht innerhalb der Frist von zwei Wochen nach § 626 Abs. 2 BGB ausgesprochen
- die Kündigungserklärung ist i.A. (im Auftrag) unterschrieben
- die Erklärung ist von einer dritten, den Arbeitnehmer nicht bekannten Person, unterzeichnet ohne Vollmachtsvorlage
Welche Fehler machen Arbeitnehmer häufig beim Erhalt einer Arbeitgeberkündigung?
Auch Arbeitnehmer machen häufig Fehler, wenn es um eine Kündigung geht. Auch gibt es immer noch diverse Fehlvorstellungen und Irrtümer in Bezug auf eine Kündigung.
Folgende Fehler von Arbeitnehmern kommen häufig vor:
- der Arbeitnehmer verschwendet Zeit in dem er Bekannte und Verwandte nach dem besten Lösungsweg fragt
- der Arbeitnehmer tritt sofort in Verhandlung mit dem Arbeitgeber und versäumt die Kündigungsfrist
- der Arbeitnehmer schreibt ein Einspruch bei einer ungerechtfertigten Kündigung und meint, dass damit alle Fristen gewahrt sind
- der Arbeitnehmer schließt einen Abwicklungsvertrag mit dem Arbeitgeber und versäumt so auf die Möglichkeit eine Abfindung zu erhalten
Wie kann sich der Arbeitnehmer am besten wehren?
Egal ob der Arbeitnehmer die Weiterbeschäftigung oder eine Abfindung erhalten möchte, es gibt im Endeffekt nur eine Möglichkeit, die der Arbeitnehmer hier ergreifen kann. Diese Möglichkeit ist die Erhebung der Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht. In Berlin ist dafür das Arbeitsgericht Berlin zuständig. Dafür hat der Arbeitnehmer nur 3 Wochen Zeit und zwar beginnt diese Klagefrist mit dem Zugang der Kündigung.
Kann man direkt auf Abfindung klagen?
Nein, eine Klage auf Abfindung ist zwar theoretisch denkbar, kommt in der Praxis aber nur in Ausnahmefällen vor. Der Arbeitnehmer, der der Abfindung haben möchte, muss in der Regel Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht einreichen. Nur selten besteht die Klagemöglichkeit direkt auf eine Entlassungsentschädigung zu klagen, so zum Beispiel beim wirksamen Auflösungsantrag des Arbeitnehmers.
Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch Abfindung?
Ein Anspruch Abfindung besteht nur in seltenen Fällen. In der Regel besteht kein Abfindungsanspruch des Arbeitnehmers bei Kündigung durch den Arbeitgeber. Dabei spielt die Art der Kündigung keine Rolle. Wenn der Arbeitnehmer eine Abfindung erhalten will, wird in der Regel Kündigungsschutzklage einreichen und im Gütetermin wird der Arbeitgeber dann mit dem Arbeitnehmer in Verhandlung treten und gegebenfalls eine Abfindung anbieten. Dies hat dann Erfolg, wenn der Arbeitgeber grundsätzlich zu einer solchen Lösung bereit ist.
Wann muss der Arbeitgeber Lohn zahlen nach der Kündigung?
Der Arbeitgeber muss nach dem Ausspruch einer Kündigung unproblematisch bis zum Ende der Kündigungsfrist den Lohn dem Arbeitnehmer zahlen. Dabei spielt es keine Rolle, ob er den Arbeitnehmer freigestellt hat oder ob dieser bis zum Ende der Frist weiter gearbeitet hat oder gegebenfalls sogar arbeitsunfähig krankgeschrieben war. Sinn und Zweck der Kündigungsfrist besteht darin, dass eine Übergangszeit geschaffen wird, in der sich der Arbeitnehmer auch anderweitig umschauen kann und nicht von heute auf morgen sein Arbeitsplatz verliert. Bis zum Ende Kündigungsfrist muss der Arbeitgeber den Arbeitslohn an den Arbeitnehmer zahlen.
Annahmeverzugslohn nach Ende der Kündigungsfrist
Schwieriger wird es dann, wenn es um die Vergütung geht, die nach der Kündigungsfrist anfällt. Hier ist es juristisch so, dass der Arbeitnehmer, wenn er den Kündigungsschutzprozess verliert der Arbeitgeber selbstverständlich keinen Lohn mehr zahlen muss, denn das Gericht stellt dann ja fest, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Ende der Kündigungsfrist beendet worden ist. Danach besteht kein Arbeitsverhältnis mehr und der Arbeitnehmer hat keinen Lohnanspruch für den Zeitraum nach Ende der Kündigungsfrist.
Arbeitnehmer gewinnt den Kündigungsschutzprozess
Anders ist es, wenn der Arbeitnehmer die Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht gewinnt. Dann stellte mich das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung zum Ende des der Kündigungsfrist aufgelöst wurde. D. h., dass das Arbeitsverhältnis bis zur Entscheidung des Gerichtes und darüber hinaus weiter besteht, der Arbeitnehmer aber keinen Lohn vom Arbeitgeber erhalten hat. Dies ist auch nicht die Schuld des Arbeitnehmers, sondern der Arbeitgeber dies verschuldet, da er faktisch eine unwirksame Kündigung ausgesprochen hat und dem Arbeitnehmer nicht ermöglicht hat seine Arbeitsleistung zu erbringen (keinen Arbeitsplatz angeboten).
Lohn beim Verzug des Arbeitgebers mit Annahme der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers
Juristen sprechen hier von sogenannten Annahmeverzugslohn. Dies ist der Lohn, der zwischen dem Ende der Kündigungsfrist und der endgültigen Entscheidung des Arbeitsgerichts bis zur Arbeitsaufnahme durch den Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu zahlen ist. Der Arbeitgeber muss also grundsätzlich den sogenannten Annahmeverzugslohn zahlen, allerdings muss sich der Arbeitnehmer den Zwischenverdienst, den er zwischenzeitlich erzielt hat, anrechnen lassen. Auch ist Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren grundsätzlich verpflichtet sich schon anderweitig um Arbeit zu bemühen und eine Arbeit aufzunehmen, allenfalls darf er aber nicht bei der Konkurrenz arbeiten.
interessante Artikel zum Thema Kündigung
Nachfolgend finden Sie weitere interessante Artikel zum Thematik Kündigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber.
- die 10 häufigsten Irrtümer!
- Kündigung während Corona-Quarantäne unzulässig!
- Kündigungsschutzklage im Arbeitsrecht
- betriebsbedingte Kündigung
- Abfindung im Arbeitsrecht
- Kündigung bei nicht unverzüglichen Anzeige der Arbeitsunfähigkeit möglich – LAG Baden-Württemberg.
- Wann muss das letzte Gehalt nach der Kündigung gezahlt werden?
- Wann ist eine Kündigung wegen Störung des Betriebsfriedens möglich?
- Kündigung bei Weigerung einer Corona-Schutzimpfung möglich?
- § 7 KSchG – Wirksamkeitsfiktion- was heißt das?
- Kann man mit einem Krankenschein die Kündigung hinauszögern?
- Welche Frist gilt bei fristloser Kündigung?
- Was ist der Schutz des Arbeitnehmers vor einer außerordentlichen Kündigung?
- Abwicklungsvertrag und Verzicht auf Erhebung der Kündigungsschutzklage
- Was ist eine vorsorgliche Kündigung?
Rechtsanwalt Arbeitsrecht Berlin – Andreas Martin – Fachanwalt
Was ist ein Inkardinationsverhältnis?

Für die Kirche in der Bundesrepublik Deutschland gilt ein besonderes Arbeitsrecht (Arbeitsrecht der Kirchen).
Gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV regeln die Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich. Dies nennt man das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Dieses Selbstbestimmungsrecht bedeutet, dass das bundesdeutsche staatliche Recht keine Anwendung findet, wenn die Kirche in ihren geistigen oder religiösen Grundsätzen betroffen ist.
Inkardinationsverhältnis
Das Inkardinationsverhältnis ist das Dienstverhältnis eines katholischen Geistlichen.
Dieses Rechtsverhältnis des katholischen Geistlichen zur katholischen Kirche nennt man Inkardinationsverhältnis.
Das Inkardinationsverhältnis wird mit der Weihe begründet. Dessen Beendigung ist die Exkardination.
In der römisch-katholischen Kirche muss jeder Kleriker inkardiniert sein. Dies in can. 265 CIC (Codex des Kanonischen Rechtes) geregelt.
Dort heißt es:
Jeder Kleriker muß entweder einer Teilkirche oder einer Personalprälatur oder einem Institut des geweihten Lebens oder einer Gesellschaft, die diese Befugnis haben, inkardiniert sein, so daß es Kleriker ohne Inkardination in keiner Weise geben darf.
Die Inkardination verpflichtet beide Seiten. So ist der inkardinierten Geistliche zum Dienst in der jeweiligen Organisation der Kirche verpflichtet und andererseits Kirche dazu, ihn in ihrem Dienst zu beschäftigen und existenziell abzusichern. Aufgrund des Inkardinationsverhältnisses hat der Geistliche nämlich gegen seinen Diözesanbischof einen Anspruch auf angemessenen Lebensunterhalt.
Arbeitsrecht anwendbar?
Das staatliche Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland ist nicht anwendbar. Der katholische Geistliche unterliegt gänzlich dem (besonderen) Kirchenrecht.
Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten?
Der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten ist aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 27.02.2014 – 2 C 19/12) ist nunmehr aber auch in dienstrechtlichen Streitigkeiten zwischen Geistlichen und Kirchenbeamten und ihrer Religionsgesellschaft aufgrund des verfassungsrechtlich gewährleisteten staatlichen Justizgewährungsanspruchs der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten eröffnet. Voraussetzung ist, dass die Verletzung staatlichen Rechts geltend gemacht wird.
Nach der obigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts können auch Geistliche oder Beamte einer Religionsgesellschaft, staatliche Gerichte anrufen, wenn und soweit sie geltend machen, ein Akt ihrer Religionsgesellschaft habe sie in ihren Rechten verletzt.
kirchliche Arbeitnehmer
Anders als die Kirchenbeamten, unterliegen die kirchlichen Arbeitnehmer dem staatlichen Arbeitsrecht. Damit kann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, auf deren Arbeitsverhältnisse das Kündigungsschutzgesetz und Sonderkündigungsschutz Anwendung finden. Allerdings werden die Voraussetzungen, die zu einer Kündigung führen können, aber grundsätzlich durch die Kirchengesetze festgelegt.
Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin – Berlin
Anwalt Arbeitsrecht Berlin – Blog

Anwalt Arbeitsrecht Berlin
Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin
Auf meinen diesen Blog (Rechtsanwalt Arbeitsrecht Berlin Blog) erhalten Sie Informationen zum Arbeitsrecht, insbesondere aktuelle Entscheidungen der Arbeitsgerichte.
Den ersten Artikel zum Arbeitsrecht habe ich im März 2009 hier veröffentlicht.
Als Author – Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin – bin ich seit dem Jahr 2003 als Anwalt zugelassen und bin vor allem am Standort in Berlin (Marzahn-Hellersdorf) im Arbeitsrecht tätig.
Überwiegend beschäftige ich mich mit Kündigungsschutz (Kündigungsschutzklagen) und berate und vertrete vor allen in der Problematik „Kündigung und Abfindung„. Ein Großteil meiner arbeitsrechtlichen Verfahren habe ich vor dem Arbeitsgericht Berlin.
Der Blog beschäftigt sich mit arbeitsrechtlichen Problemen und vor allen aktuellen Entscheidung der Landesarbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgericht sowie der Rechtsprechung des EuGH, soweit diese Bezug zum Arbeitsrecht hat.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Berlin-Brandenburg.
Innerhalb des Arbeitsrechtes geht es vor allem dann um Artikel und Entscheidungen zur Thematik Kündigung, Abfindung, Kündigungsschutz, Lohn, Urlaub, Überstundenvergütung, Haftung des Arbeitnehmers und anderen Bereichen des Arbeitsrechts.
Viel Spaß beim Lesen!
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Erweiterter Kündigungsschutz nach neuen Mutterschutzgesetz!
Das Mutterschutzgesetz wurde 2017 reformiert und zum 1.1.2018 sind die Änderungen in Kraft getreten. Eine Änderung hatte es bereits zum 30.5.2017 in Bezug auf den Sonderkündigungsschutz bei einer Fehlgeburt gegeben.

Sonderkündigungsschutz nun in § 17 Mutterschutzgesetz
Der Sonderkündigungsschutz („Kündigungsverbot“) findet sich seit dem 1. Januar 2018 nun in § 17 MuSchG.
Dieser lautet in Abs. 1:
§ 17 Kündigungsverbot
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig
1.
während ihrer Schwangerschaft,
2.
bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und
3.
bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung,
wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündigung der Frau trifft.
Kündigungsverbot entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen
Eine der erhebliche Änderungen befindet sich in § 17 Abs. 1 Satz 3 MuSchG, nämlich die Ausweitung des Kündigungsschutzgesetzes auch „für Vorbereitungsmaßnahmen“ des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündigung der Arbeitnehmerin (Frau) trifft.
Solche Vorbereitungsmaßnahmen führen dazu, dass eine anschließende Kündigung des Arbeitgeber gem. § 134 BGB nichtig ist.
Vorbereitung eines dauerhaften Ersatzes der Arbeitnehmerin
Nun kann man sich nach dem ersten Blick ins Gesetz wenig unter solchen Vorbereitungsmaßnahmen vorstellen. Der Hintergrund ist der, dass der EuGH Urteil vom 11.10.2007 – 0-460/06, NZA2007, 1271) dem Gesetzgeber dazu angehalten hat, die Arbeitnehmerin vor solche Maßnahmen ebenfalls zu schützen.
Eine solche Vorbereitungsmaßnahme kann zum Beispiel die Suche nach einem neuen Arbeitnehmer sein, der dann die sich in Mutterschutz befindliche Arbeitnehmerin dauerhaft ersetzen soll.
Wenn also die Arbeitnehmerin später nachweisen kann, dass der Arbeitgeber bereits während des Mutterschutzgesetzes nach einer neuen Mitarbeiterin gesucht hat um die sich im Mutterschutz befindliche Arbeitnehmer zu ersetzen, dann ist eine spätere Kündigung – auch nach den Schutzfristen – nichtig! Dies kann den zeitlichen befristeten Sonderkündigungsschutz erheblich erweitern. Andererseits ist auch klar, dass ein solcher Nachweis nicht immer einfach ist.
Dauer des Sonderkündigungsschutzes
Die Dauer des Sonderkündigungsschutzes bestimmt sich gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MuSchG, wonach gilt, dass während der gesamten Schwangerschaft sowie 4 Monate nach der Entbindung keine Kündigung des Arbeitgebers erfolgen darf.
Neuregelung für Frühgeburten
Neu ist eine Sonderregelung, wonach Kündigungsschutz nach der
Entbindung in jedem Fall so lange anhält, wie ein Beschäftigungsverbot nach § 3 MuSchG besteht. Ausgeweitet ist der Sonderkündigungsschutz damit für Frühgeburten (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 MuSchG). In diesem Fall verlängert sich das Beschäftigungsverbot nämlich um die Differenz zwischen dem prognostizierten Geburtstermin und der tatsächlichen Entbindung (Frühgeburt). Eine Auswirkung hat dies nur dann, wenn das Kind etwas mehr als 2 Monate vor dem errechneten Geburtstermin geboren wird.
Neuregelung für Fehlgeburten
Neu eingeführt wurde der Kündigungsschutz von 4 Monaten (§17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MuSchG) für Frauen, die nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden. Damit soll der besonderen Belastung einer Fehlgeburt Rechnung getragen werden, was nur zu begrüßen ist. Von daher besteht der Sonderkündigungsschutz auch, wenn das Kind im Sinne des § 31 Abs. 2 PStV (Personenstandsverordnung) tot geboren wird. Dies war zuvor nicht so.
Anforderungen an Kündigung während der Schutzfristen
Während der Schutzfristen besteht ein Kündigungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Der Arbeitgeber braucht für die Kündigung die Zustimmung der obersten Landesbehörde. Die Kündigung muss darüber hinaus den formellen Anforderungen genügen. Sie muss schriftlich erfolgen (§ 17 Abs. 2, Satz 2 MuSchG; aber schon in § 623 BGB geregelt) und die Kündigung muss begründet werden, was normalerweise nicht Voraussetzung ist. Eine nicht begründete Kündigung ist nach § 134 BGB unwirksam.
Rechtsanwalt Andreas Martin- Fachanwalt für Arbeitsrecht – Berlin Marzahn-Hellersdorf
BAG: Wiedereinstellungsanspruch nach Kündigung besteht nicht im Kleinbetrieb!
Ein Kleinbetrieb ist ein Betrieb mit regelmäßig weniger als 10 Arbeitnehmer in Vollzeit abzüglich der Auszubildenden. Im Kleinbetrieb gibt es für die Arbeitnehmer keinen allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Der Arbeitgeber kann also ohne Kündigungsgrund ordentlich das Arbeitsverhältnis beenden. Nur in Ausnahmefällen gibt es eine Möglichkeit die Kündigung erfolgreich anzugreifen, nämlich ,wenn ein Sonderkündigungsschutz oder ein Mindestkündigungsschutz greift. Dies ist selten der Fall.
Nun zum Fall des Bundesarbeitsgericht:
Der Arbeitnehmer/ Kläger war seit 1987 bei seiner Arbeitgeberin in einer Apotheke beschäftigt. Mit Schreiben vom 28. November 2013 kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer/ Kläger sowie mit allen übrigen Beschäftigten zum 30. Juni 2014 (wahrscheinlich sollte der Betrieb angeblich aufgegeben werden).Beim Betrieb handelte es sich um einen Kleinbetrieb.
Der Arbeitnehmer / Kläger, der keinen Kündigungsschutz nach dem KSchG genoss (da Kleinbetrieb) , hat die Kündigung Der Arbeitgeberin nicht mittels Kündigungsschutzklage angegriffen.
Anders als mitgeteilt, führte dann aber die Arbeitgeberin über den 30. Juni 2014 hinaus mit verringerter Beschäftigtenzahl den Betrieb weiter und veräußerte diesen sogar einschließlich des Warenlagers an eine andere Apothekerin. In dem Kaufvertrag über die Veräußerung der Apotheke hatte die „neue Inhaberin“ sich zudem zur Übernahme und Weiterbeschäftigung von drei Arbeitnehmern verpflichtet.
Der Kläger hat mit seiner Klage zunächst sowohl die vormalige Arbeitgeberin als auch die neue Inhaberin auf Wiedereinstellung in Anspruch genommen und vor dem Arbeitsgericht geklagt.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Kläger hat das arbeitsgerichtliche Urteil der 1. Instanz mit der Berufung zum LAG Düsseldorf nur insoweit angegriffen, als seine gegen neue Betriebsinhaberin gerichtete Klage abgewiesen wurde.
Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers zum BAG hatte keinen Erfolg.
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19. Oktober 2017 – 8 AZR 845/15) führt in seiner Pressemitteilung vom 19.102017 mit der Nr. 46/17 folgendes aus:
Ein Wiedereinstellungsanspruch kann grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen, die zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung Kündigungsschutz nach dem KSchG genießen. Ob sich in Kleinbetrieben im Einzelfall ausnahmsweise aus § 242 BGB ein Wiedereinstellungsanspruch ergeben kann, bedurfte vorliegend keiner Entscheidung. Der Kläger hätte einen solchen Anspruch erfolgreich nur gegenüber der vormaligen Beklagten zu 1., die den Betrieb nach Ablauf der Kündigungsfrist des Klägers zunächst weitergeführt hatte, verfolgen können. Seine gegen die vormalige Beklagte zu 1. gerichtete Klage war aber rechtskräftig abgewiesen worden.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Fachanwalt für Arbeitsrecht


