AGG
„Digital Native“ in einer Stellenausschreibung – Diskriminierung?
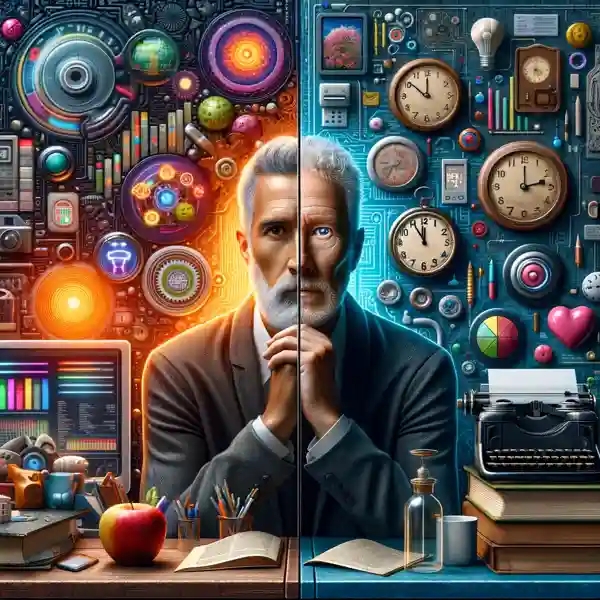
Stellenausschreibungen von Firmen im Internet oder über Zeitungen führen oft dazu, dass Personen, die abgelehnt werden, sich später an das Arbeitsgericht wenden und eine Entschädigung fordern.
AGG und Diskriminierung bei Stellenanzeigen
Die Ausschreibungen müssen korrekt sein und dies wird immer noch von vielen Firmen übersehen.
Neben der Frage, dass geschlechtsneutral Ausschreibungen zu erfolgen haben, ist auch zu beachten, dass keine bestimmten Personengruppen von vornherein ausgeschlossen werden.
AGG-Hopping
Hier passieren immer wieder Fehler, obwohl mittlerweile sich herumgesprochen hat, dass es Bewerber gibt, die sich nur bewerben, um später einen Entschädigungsanspruch geltend machen zu können. Dies nennt man AGG-Hopping.
Das Arbeitsgericht Heilbronn (Urteil vom 18. Januar 2024 -Aktenzeichen 8 Ca 191/23) hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Arbeitnehmer einen Entschädigungsanspruch gelten machen kann, wenn er sich beworben hatte und abgelehnt wurde auf eine Stellenausschreibung, in der mit „Digital Native“ geworben wurde.
Basierend auf dem Urteil des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 18. Januar 2024 (Aktenzeichen 8 Ca 191/23) bezüglich einer Entschädigung wegen Altersdiskriminierung bei einer Einstellung, lässt sich ein Artikel wie folgt strukturieren:
Digital Native
Der Fall drehte sich um die Verwendung des Begriffs „Digital Native“ in einer Stellenanzeige, der als Indiz für eine Altersdiskriminierung gewertet wurde. Dieses Urteil betont die Bedeutung eines bewussten und diskriminierungsfreien Sprachgebrauchs in Stellenausschreibungen. Dass dies nicht immer möglich ist, wissen aber Juristen.
Sachverhalt
Der Kläger, ein im Jahr 1972 geborener Diplomwirtschaftsjurist, bewarb sich im April 2023 auf eine von der Beklagten, einem international agierenden Handelsunternehmen im Bereich Sportartikel, ausgeschriebene Position als Manager Corporate Communication. Die beklagte „Arbeitgeberin“ hatte in ihrer Stellenausschreibung unter anderem formuliert, dass sich Bewerber als „Digital Native“ in der Welt der sozialen Medien und verwandten Technologien zu Hause fühlen sollten. Nachdem der Kläger eine Absage erhalten hatte, machte er einen Entschädigungsanspruch wegen Altersdiskriminierung geltend, da er der Ansicht war, die Formulierung „Digital Native“ ziele darauf ab, jüngere Bewerber zu bevorzugen. Der Kläger wollte hier eine Entschädigung von € 37.500 (5 Montatsgehälter a € 7.500)!
Entscheidungsgründe
Das Arbeitsgericht stellte fest, dass die Verwendung des Begriffs „Digital Native“ in der Tat ein Indiz für eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters darstellt. Insgesamt war die Ausschreibung so gehalten, dass diese sich vor allem an jüngere Bewerber richtete.
Arbeitsgericht Heilbronn
Die beklagte Firma konnte nicht widerlegen, dass andere Gründe als das Alter des Klägers zu dessen Benachteiligung geführt hatten. Dem Kläger wurde daher eine Entschädigung in Höhe von 7.500 Euro (zugesprochen, was 1, 5 Bruttomonatsgehältern – nach der Berechnung des Gerichts) entsprach. Das Gericht argumentierte, dass eine Entschädigung in dieser Höhe notwendig und angemessen sei, um den immateriellen Schaden des Klägers zu kompensieren und eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Ausführungen des Gerichts
Arbeitsgericht Heilbronn
Besteht die Vermutung einer Benachteiligung nach § 22 AGG, trägt die andere Partei die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt worden ist. Hierfür gilt allerdings das Beweismaß des sogenannten Vollbeweises. Der Arbeitgeber muss Tatsachen vortragen und gegebenenfalls beweisen, aus denen sich ergibt, dass ausschließlich andere als die in § 1 AGG genannten Gründe zu einer ungünstigeren Behandlung geführt haben (BAG 23. Januar 2020 – 8 AZR 484/18 – Rn. 36 mit weiteren Nachweisen). Es genügt also nicht der Nachweis, dass es nicht diskriminierende Gründe gibt, die die Differenzierung hätten rechtfertigen können, sondern nur der Nachweis, dass ausschließlich diese Kriterien im konkreten Fall verwendet wurden. Das kann etwa durch Offenlegung der Dokumentation des Ablaufs der benachteiligenden Entscheidung erfolgen, durch Berücksichtigung älterer Bewerber trotz an „junge“ gerichteter Ausschreibung im selben Besetzungsverfahren oder durch die Berücksichtigung anderer Merkmalsträger für die Teilnahme an der zweiten Stufe eines Auswahlverfahrens.
FAQ
Was versteht man unter Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess?
Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess liegt in der Regel vor, wenn ein Bewerber aufgrund seines Alters weniger günstig behandelt wird als andere Bewerber in einer vergleichbaren Situation. Dies kann sich in der Formulierung von Stellenausschreibungen, der Auswahl der Bewerber für Vorstellungsgespräche oder der endgültigen Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten manifestieren.
Wie kann ich erkennen, ob eine Stellenanzeige altersdiskriminierend ist?
Eine Stellenanzeige könnte als altersdiskriminierend angesehen werden, wenn sie Begriffe oder Formulierungen enthält, die eine Präferenz für Bewerber eines bestimmten Alters suggerieren, z.B. „junges dynamisches Team“ oder die explizite Suche nach „Digital Natives“. Solche Formulierungen können ältere Bewerber indirekt ausschließen.
Welche Beweislastregelungen gelten bei Verdacht auf Altersdiskriminierung?
Nach § 22 AGG trägt die Partei, die sich diskriminiert fühlt, die Beweislast dafür, Indizien vorzubringen, die auf eine Diskriminierung hindeuten. Kann diese Person solche Indizien glaubhaft machen, verschiebt sich die Beweislast auf den Arbeitgeber, der dann nachweisen muss, dass keine Diskriminierung vorliegt und die Entscheidung auf anderen, legitimen Gründen basiert.
Anmerkung:
Wenn man schon englische Begriffe in einer Bewerbung verwendet, sollte man auch verstehen, was dies (rechtlich) bedeutet. Viele Firmen bekommen die Stellenanzeigen noch nicht einmal auf Deutsch rechtlich sauber formuliert. Man sollte von daher mit allen Hinweisen in der Anzeige sehr vorsichtig umgehen, aus denen man schließen könnte, dass junge Bewerber bevorzugt werden. Dies war hier das Problem der Beklagten.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Altersdiskriminierung – „junges, hochmotiviertes Team“-€ 6.700 Entschädigung.

Diskriminierung wegen Alters:
Gerade bei Stellenanzeigen sollten Arbeitgeber sehr sorgfältig sein. Bei ausgeschriebenen Stellen bevorzugen Arbeitgeber gern junge Mitarbeiter, die insbesondere noch „formbar“ und wahrscheinlich auch „flexibler“ sind. Ein älterer Arbeitnehmer mit entsprechender Erfahrung lässt eben nicht alles mit sich machen und sagt auch schon mal nein, wenn wieder Überstunden anfallen.
Stellenanzeigen müssen altersneutral sein
Auf keinen Fall darf aber in der Stellenanzeige eine solche Motivation des Arbeitgebers erkennbar sein. Hier soll dahinstehen, ob eine solche Intention von Arbeitgeberseite aus überhaupt in irgendeiner Weise vertretbar ist. Meiner Ansicht nach ist der Jugendwahn bei Arbeitgebern nicht nachvollziehbar. Gerade ältere Arbeitnehmer verfügen über Erfahrungen im Beruf, die für Arbeitgeber wertvoll sind.
keine Stellenausschreibung mit diskriminierenden Inhalt erlaubt
Juristisch gesehen ist dies aber eindeutig. Wenn der Arbeitgeber bei der Stellenausschreibung junge Mitarbeiter sucht, dann liegt eine Diskriminierung gegenüber älteren Stellenbewerbern vor.
AGG – gesetzliche Regelung gegen Altersdiskriminierung
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet eine solche Diskriminierung und gibt den Stellenbewerbern, die hier wegen ihres Alters diskriminiert wurden, die Möglichkeit eine Entschädigung vom Arbeitgeber zu verlangen.
Voraussetzung ist aber, dass kein AGG-Hopping vorliegt und insbesondere die Bewerbung ernst gemeint war.
Fall des Landesarbeitsgericht Nürnberg
Über einen solchen Fall hatte nun das Landesarbeitsgericht Nürnberg (LArbG Nürnberg, Urteil v. 27.05.2020 – 2 Sa 1/20) zu entscheiden.
Und zwar schrieb ein Softwareunternehmen eine Stelle aus und zwar wie folgt: „zukunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem jungen, hochmotivierten Team“.
junges, hochmotiviertes Team = Diskriminerung wegen Alters?
So könnte man meinen, dass ja kein junger Mitarbeiter ausgeschrieben wurde, allerdings ist der Zusammenhang zwischen dem Mitarbeiter und dem jungen hochmotivierten Team erkennbar, sodass ich gerade junge Mitarbeiter angesprochen und ältere nicht angesprochen und ausgegrenzt worden sind.
61-jähriger Bewerber klagte wegen Altesdiskriminierung
Ein 61-jähriger Bewerber schrieb eine 18-seitige Bewerbung und erfüllt auch die Voraussetzungen für die Stelle. Er wurde nicht angenommen. Daraufhin erhob Entschädigungsklage und verlangte drei Monatsgehälter als Entschädigung.
Entschädigung von € 6.700
Das Landesarbeitsgericht Nürnberg sprach dem Bewerber letztendlich eine Entschädigung von 6700 € zu.
Das Landesarbeitsgericht sah hier eine Diskriminierung des 61-jährigen durch die Stellenanzeige und führte dazu in der Urteilsbegründung aus:
Die Formulierung in der Stellenausschreibung, wonach dem/der Bewerber/in eine zukunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem „jungen, hochmotivierten Team“ geboten wird, bewirkt eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters iSv. § 3 Abs. 1 AGG. Das erkennende Gericht folgt der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahre 2016 zu Stellenangeboten, die mit der Mitarbeit in einem „jungen, dynamischen Team“ warben (BAG 19.05.2016 – 8 AZR 470/14 und 11.08.2016 – 406/14). Die Verwendung der Begriffe dynamisch und hochmotiviert in einer Stellunganzeige im Zusammenhang mit einem jungen Team sind austauschbar und unterscheiden sich in der Zielsetzung kaum.
Mit dem Begriff „jung“ wird unmittelbar an das Lebensalter angeknüpft. Verstärkt wird diese Bezugnahme auf das Lebensalter durch die Verbindung mit dem Begriff „hochmotiviert“, der ebenso wie der Begriff „dynamisch“ eine Eigenschaft beschreibt, die im Allgemeinen eher jüngeren als älteren Menschen zugeschrieben wird. Wird in einer Stellenausschreibung – wie hier – darauf hingewiesen, dass eine zukunftsorientierte Mitarbeit in einem „jungen hochmotivierten Team“ geboten wird, enthält dieser Hinweis regelmäßig nicht nur die Botschaft an potentielle Stellenbewerber/innen, dass die Mitglieder des Teams jung und deshalb hochmotiviert sind. Eine solche Angabe in einer Stellenanzeige kann aus der Sicht eines objektiven Empfängers zudem regelmäßig nur so verstanden werden, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin sucht, der/die in das Team passt, weil er/sie ebenso jung und hochmotiviert ist wie die Mitglieder des vorhandenen Teams. Die Annahme, dass mit der Beschreibung des Teams als „jung“ und „hochmotiviert“ der Zweck verfolgt wird, den potentiellen Bewerber/die potentielle Bewerberin darüber zu informieren, dass das Team selbst noch nicht lange Zeit besteht, ist demgegenüber fernliegend, wenn dieser Umstand nicht zugleich in der Stellenausschreibung erläutert wird. Sofern dies – wie hier – nicht der Fall ist, kann der Zweck einer solchen Stellenbeschreibung nur darin bestehen, einen zum vorhandenen Team passenden neuen Beschäftigten zu gewinnen. Andernfalls wäre die so formulierte Stellenbeschreibung ohne Aussagegehalt und damit überflüssig. Dies stimmt mit der Behauptung der Beklagten überein, das Durchschnittsalter des Teams betrage 38 Jahre.
Anmerkung:
Die Entscheidung ist richtig. Der einzige Grund eine solche Stellenausschreibung zu formulieren ist, dass man nach jungen Mitarbeitern sucht. Dafür gab es jetzt den Denkzettel.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht Berlin
Warum eine Schule nicht eine“Fachlehrerin Sport (w)“ suchen sollte?
Klagen auf Entschädigung wegen angeblicher Diskriminierung kommen bei den Arbeitsgerichten oft vor. Dabei geht fast immer um das Bewerbungsverfahren und zwar entweder um die Stellenausschreibung oder um der Verfahren an sich. Mittlerweile ist dies auch bei vielen Arbeitgebern bekannt (Stichwort: AGG-Hopping). Nur bei ernsthafter Bewerbung ist eine Entschädigung denkbar.
Benachteiligungsverbot
Nach § 1 des AGG ist es Ziel des Gesetzes, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.Trotzdem kann es manchmal vorkommen, dass eine Stellenausschreibung zunächst benachteiligend ist oder keine Diskriminierung vorliegt, wenn es nämlich für die „Benachteiligung“ einen sachlichen Grund gibt.
Sachlicher Grund für die Benachteiligung?
Nach § 8 Abs. 1 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.
Entschädigung bei Diskriminierung
Liegt aber eine Diskriminierung vor (also, wenn es für die Benachteiligung keinen sachlichen Grund gibt), dann kann der Betroffene eine Entschädigung verlangen und diese beim Arbeitsgericht einklagen.
Nach § 15 Abs. 2 AGG kann wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt werden. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.
Fall des Bundesarbeitsgerichts
Das Bundesarbeitsgericht hatte sich nun mit folgendem Fall zu beschäftigen:
Ein Bewerber hatte sich im Juni 2017 ohne Erfolg bei einer Privatschule in Bayern erfolglos beworben. Die Schule hatte nämlich eine Stelle als Lehrer mit
„Fachlehrerin Sport (w)“ ausgeschrieben.
Benachteiligung wegen seines männlichen Geschlechts
Der Bewerber meinte, dass er aufgrund seines männlichen Geschlechts benachteiligt wurde und verlangt von der Schule eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG.
Grund für die Ungleichbehandlung- „Schamgefühl der Schülerinnen“
Die Schule widerum trug im Verfahren vor dem Arbeitsgericht vor, dass die Nichtberücksichtigung des Bewerbers im Stellenbesetzungsverfahren nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig gewesen sei. Es gab einen sachlichen Grund, nämlich dass das Schamgefühl von Schülerinnen beeinträchtigt werden könnte, wenn es bei Hilfestellungen im nach Geschlechtern getrennt durchgeführten Sportunterricht zu Berührungen der Schülerinnen durch männliche Sportlehrkräfte komme bzw. diese die Umkleideräume betreten müssten, um dort für Ordnung zu sorgen.
Klage des Bewerbers erfolgreich beim BAG
Die Vorinstanzen haben die Klage des Bewerbers abgewiesen. Die Revision des Klägers hatte vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Die Entscheidung des BAG führte zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung.
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19. Dezember 2019 – 8 AZR 2/19) führt dazu in seiner Pressemitteilung Nr. 48/19 vom 19.12.2019 aus:
Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts kann nach § 8 Abs. 1 AGG in unionsrechtskonformer Auslegung nur zulässig sein, wenn es um den Zugang zur Beschäftigung einschließlich der zu diesem Zweck erfolgenden Berufsbildung geht und ein geschlechtsbezogenes Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.
Der Kläger hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG. Entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts hat der Beklagte nicht den Vorgaben des AGG und des Unionsrechts entsprechend dargetan, dass für die streitgegenständliche Stelle ein geschlechtsbezogenes Merkmal eine wesentliche und entscheidende sowie angemessene berufliche Anforderung iSv. § 8 Abs. 1 AGG ist. Über die Höhe der Entschädigung konnte der Senat aufgrund der bislang vom Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen nicht selbst entscheiden.
Anmerkung:
Die Entscheidung des BAG ist richtig. Ansonsten dürfte es an gemischten Schulen nur noch Sportlerinnen geben. Und was wäre dann mit dem „Schamgefühl“ der männlichen Schüler?
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fettleibigkeit kein Kündigungsgrund
Das Arbeitsgericht Düsseldorf (Urteil vom 17.12.2015 – 7 Ca 4616/15) entschied, dass Fettleibigkeit allein kein ausreichender Kündigungsgrund für eine personenbedingte Kündigung sei; auch dass die Kündigung wegen der Fettleibigkeit keine Diskrminierung des Arbeitnehmers wegen einer Behinderung sei.
Ein Arbeitnehmer, der in einem Gartenbaubetrieb arbeitete, litt unter Adipositas (Fettleibigkeit). Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis mit der Begründung, dass der Arbeitnehmer aufgrund seiner Körperfülle nicht mehr in der Lage sei seine Arbeitsleistung zu erbringen.
Gegen die Kündigung des Arbeitgeber erhob der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage und beantrage ebenso eine Entschädigung wegen einer Diskriminierung aufgrund seiner Behinderung (Fettleibigkeit).
Dem Kündigungsschutzantrag gab das Arbeitsgericht statt, während es keinen Entschädigungsanspruch sah.
Die Fettleibigkeit allein ist kein ausreichender Kündigungsgrund. Der Arbeitgeber konnte im Prozess nicht ausreichend vortragen, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen konnte.
Andererseits ist keine Entschädigung zu zahlen, da Fettleibigkeit für sich keine Behinderung sei (diese könne aber in schweren Fällen zu einer solchen führen, was hier nicht der Fall war) und von daher auch keine Benachteiligung aufgrund einer Behinderung durch die Kündigung vorliegen würde.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein: schriftlicher Einstellungstest ersetzt kein Vorstellungsgespräch
Ein öffentlicher Arbeitgeber ist grundsätzlich nach § 82 S. 2 SGB IX verpflichtet einen schwerbehinderten Bewerber zum Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern dieser nicht offensichtlich fachlich ungeeignet ist.
Ein solches erforderliches Vorstellungsgespräch kann auch nicht durch einen für alle Bewerber verbindlichen schriftlichen Auswahltest ersetzt werden.
Ein öffentliche Arbeitgeber schrieb den Ausbildungsplatz zum Verwaltungsinformatiker aus. Ein schwerbehinderter Bewerber erfüllte die fachlichen Voraussetzungen bewarb sich auf die Stelle. Der Arbeitgeber führte einen schriftlichen Eignungstest durch, welchen der schwerbehinderte Bewerber nicht bestand. Dieser erhielt darauf hin eine Absage vom Arbeitgeber.
Zu einem Vorstellungsgespräch wurde der schwerbehinderte Bewerber nicht geladen.
Der Bewerber verlangte daraufhin eine Entschädigung vom Arbeitgeber wegen einer Diskriminierung aufgrund seiner Eigenschaft als Schwerbehinderter nach dem AGG. Er begründete dies damit, dass er als schwerbehinderter Bewerber zwingend zum Vorstellungsgespräch hätte eingeladen werden müssen.
Der Kläger/der Schwerbehinderte gewann den Rechtstreit sowohl in der 1. Instanz als auch das Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig Holstein ( Urteil vom 9.9.15 – 3 Sa 36/15).
Das LAG Schleswig Holstein führte dabei aus, dass ein schriftlicher Eignungstest nicht das Vorstellungsgespräch nach § 82 S. 2 SGB IX ersetzen würde.
Der Arbeitgeber wurde zu einer Zahlung einer Entschädigung in Höhe von zwei Bruttomonatsvergütungen verurteilt.
Rechtsanwalt Andreas Martin
LAG Berlin-Brandenburg: zweifache Kündigung einer Schwangeren führt zu Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung!
Ein Kollege (Anwalt) kündigte zunächst seine schwangeren Sekretärin ohne Kenntnis von deren Schwangerschaft. Diese informierte den Rechtsanwalt und die Arbeitnehmerin gewann das Kündigungsschutzverfahren. Einige Monate später kündigte der Anwalt erneut ohne Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde. Zu diesem Zeitpunkt wusste er aber bereits von der Schwangerschaft.
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom 16.09.2015, Aktenzeichen 23 Sa 1045/15) bestätigte nun im Berufungsverfahren das Urteil des Arbeitsgerichts und führte aus (in der Pressemitteilung):
Durch die erneute Kündigung wurde die Klägerin nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts wegen ihres Geschlechts benachteiligt. Der Einwand des Arbeitgebers, er habe angenommen, die Schwangerschaft sei bereits beendet, hat das Gericht für unberechtigt gehalten. Es hätten keine Anhaltspunkte für ein Ende der Schwangerschaft vorgelegen; auch sei die Klägerin nicht verpflichtet gewesen, den Arbeitgeber stets von dem Fortbestand der Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an das Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.
Anmerkung:
Die Besonderheit des Falles besteht darin, dass der Anwalt zweimal das Arbeitsverhältnis mit seiner schwangeren Arbeitnehmerin beenden wollte. Beim ersten Mal wusste er nicht, dass diese schwanger ist und von daher liegt auch keine bewusste Diskriminierung vor. Bei der zweiten Kündigung wusste er dies aber und von daher wurde eine Diskriminierung angenommen und der Anwalt muss sich hier eine Entschädigung zahlen.
Rechtsanwalt Andreas Martin
LAG Hessen: Bewerber sollen „Deutsch als Muttersprache“ beherrschen – Diskriminierung.
Ein Arbeitgeber schrieb eine befristete Stelle als Bürokraft aus und betonte in der Stellenanzeige, dass Bewerber „Deutsch als Muttersprache“ beherrschen müssten.
Ein aus Russland stammender Bewerber, der eben nicht Deutsch als Muttersprache sprach, aber sehr gute Deutschkenntnisse hatte und von daher für die Stelle geeignet war, bewarb sich, wurde aber nicht eingestellt. Eine Ablehnung erhielt er nicht; erfuhr aber später von der Besetzung der Stelle durch einen anderen Bewerber.
Der russische Arbeitnehmer meinte, dass er aufgrund seiner ethnischen Herkunft benachteiligt und diskriminiert worden sei, da er eben kein deutscher Muttersprachler sei.
Er klagte vor dem Arbeitsgericht auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Die Berufung zum LAG Hessen (Urteil vom 15.6.2015, 16 Sa 1619/14) hatte Erfolg. Das Landesarbeitsgericht Hessen verurteilte den „Arbeitgeber“ zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 2 Monatsgehältern. Die Entscheidung ist aber nicht rechtskräftig, da noch die Revision zum BAG läuft.
Das LAG betonte, dass die ausschreibende Firma (Arbeitgeber) den russischen Bewerber wegen seiner Ethnie nach § 1 AGG benachteiligt habe. Der Bewerber werde wegen seine Nichtzugehörigkeit zur deutschen Ethnie unabhängig von seinen tatsächlichen Sprachkenntnisse von vornherein ausgeschlossen. Ein sachlicher Grund für eine solche Benachteiligung ist nicht ersichtlich. Auch ein sehr gut Deutsch sprechender Ausländer hätte hier die fachlichen Voraussetzungen für die Stelle vorweisen können.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Kann ein Arbeitnehmer die Kündigung eines Arbeitskollegen vom Arbeitgeber verlangen?
Arbeitskollegen kommen nicht immer gut miteinander aus. Probleme untereinander führen aber nicht dazu, dass ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Entlassung eines Arbeitskollegen verlangen kann.
Anspruch auf Entlassung von Arbeitskollegen?
Es sind aber (Ausnahme-) Fälle denkbar, bei denen tatsächlich ein solcher Anspruch auf Kündigung eines Kollegen bestehen kann.
Entscheidung des Arbeitsgerichts Solingen
Das Arbeitsgericht Solingen (Urteil vom 24.2.2015 – 3 Ca 1356/13) hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Ein Arbeitnehmer behauptete, dass er während einer Dienstreise von seinem Vorgesetzten sexuell missbraucht wurde. Der Vorgesetzte wurde strafrechtlich zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt; das Urteil war aber noch nicht rechtskräftig.
Der Arbeitnehmer verlangte nun von seinem Arbeitgeber, dass dieser den Vorgesetzten kündigen sollte. Da der Arbeitgeber dies verweigerte, klagte der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht darauf, dass der Arbeitgeber zur Kündigung des Vorgesetzten verpflichtet werden sollte.
Das Arbeitsgericht Sollingen wies die Klage des Arbeitnehmers ab, führte aber aus, dass grundsätzlich ein solcher Anspruch auf Kündigung eines Arbeitskollegen bestehen könnte, hier aber nicht ausreichend bewiesen ist.
In seiner Pressemitteilung führte das Arbeitsgericht Solingen aus:
Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Diese sei zwar überwiegend zulässig. Auch habe ein Arbeitnehmer nach § 12 Abs. 3 AGG Anspruch auf die Ausübung rechtsfehlerfreien Ermessens durch den Arbeitgeber. Wenn nach objektiver Betrachtungsweise eine rechtsfehlerfreie Ermessensentscheidung des Arbeitgebers nur das Ergebnis haben könne, eine bestimmte Maßnahme (wie etwa eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses) zu ergreifen, so habe der Arbeitnehmer Anspruch auf deren Durchführung. Eine solche Ermessensreduzierung sei bei einem sexuellen Missbrauch möglich. Allerdings steht aufgrund der Beweisaufnahme nicht zur vollen Überzeugung der zuständigen Kammer fest, dass der Vorgesetzte den Kläger sexuell missbraucht hat. Im Rahmen einer Analyse der Zeugenaussagen und der Anhörung des Klägers ist zwar die Darstellung des Klägers überwiegend wahrscheinlich, da diese mehr sogenannte Realkennzeichen aufweist, die für die Glaubhaftigkeit sprechen. Allerdings verbleiben Zweifel, so dass der Kläger das Beweislastrisiko zu tragen hat.
Anmerkung:
Bemerkenswert ist, dass das Gericht hier einen Anspruch auf Verpflichtung des Arbeitgebers zur Kündigung grundsätzlich als möglich ansah, wahrscheinlich aufgrund der schweren Vorwürfe. Andere mildere Maßnahmen (z.B. Versetzung etc) waren wahrscheinlich hier nicht denkbar. Allerdings ist dem Arbeitnehmer der komplette Nachweis des sexuellen Mibrauchts vor dem Arbeitsgericht nicht gelungen. Wahrscheinlich wird sich der interessierte Leser nun fragen, wie es sein kann, dass der Vorgesetze vor dem Strafgericht schuldig gesprochen wurde und das Arbeitsgericht hier Zweifel am Tatgeschehen hatte.
Dabei ist zu bedenken, dass zum einen das Strafurteil noch nicht rechtskräftig war und zum anderen auch ein Strafurteil keine Beweisaufnahme im „Zivil- und Arbeitsgerichtsverfahren“ ersetzt. Die Zivil-und Arbeitsgerichte sind an Urteile der Strafgerichte nicht gebunden und umgekehrt. Im Strafverfahren gibt es andere prozessuale Grundsätze; hier kann z.B. der Geschädigte Zeuge sein, während im Zivil- und Arbeitsgerichtsverfahren dieser „nur“ Partei ist.
Rechtsanwalt Andreas Martin
LAG R-P: Frauen haben Anspruch auf Entschädigung bei geringerer Bezahlung als männliche Kollegen
Wer weiblichen Angestellten für die gleiche Arbeit weniger Geld bezahlt als den männlichen oder umgekehrt, diskriminiert die jeweilige Gruppe aufgrund ihres Geschlechts und muss die Lohndifferenz nachzahlen und im schlimmsten Fall auch nach Entschädigung nach dem AGG zahlen.
Die Klägerin – eine Frau- ist seit 01.07.1996 bei der Beklagten als einfache Produktionsmitarbeiterin beschäftigt. Die Beklagte, eine Schuhherstellerin, beschäftigt rund 170 Arbeitnehmer. Die Beklagte zahlte bis zum 31.12.2012 an die in der Produktion beschäftigten Frauen bei gleicher Tätigkeit einen geringeren Stundenlohn als den Männern.
|
Die Beklagte zahlte |
der Klägerin |
vergleichbaren |
Differenz |
|
2009 |
€ 8,54 |
€ 9,76 |
€ 1,22 |
|
2010, 2011, 2012 |
€ 8,72 |
€ 9,86 |
€ 1,14 |
Aufgrund der Ungleichbehandlung verklagte die Arbeitnehmerin den Arbeitgeber auf rückständigen Lohn iHv. € 12.156,88 brutto sowie – weiter- ihr wegen Verstoßes gegen das AGG eine angemessene Entschädigung nach dem AGG zu zahlen, die sich jedoch auf mindestens € 9.194,50 belaufen sollte.
Das Arbeitsgericht Koblenz verurteilte den Arbeitgeber rückständigen Arbeitslohn in Höhe von € 7.543,57 brutto und eine Entschädigung in Höhe von iHv. € 3.537,18 zu zahlen.
Gegen das Urteil der ersten Instanz legten beide Parteien Berufung zum Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz ein.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 14.8.2014 – 5 Sa 509/13) kam zu keinem höheren Lohnanspruch, wie die ersten Instanz, aber erhöhte die Entschädigung auf EUR 6.000 und führte dazu aus:
2. Das Arbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass der Klägerin ein Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG zusteht, weil sie von der Beklagten wegen ihres Geschlechts beim Entgelt benachteiligt worden ist. Auf die Berufung der Klägerin ist der vom Arbeitsgericht festgesetzte Entschädigungsbetrag auf € 6.000,00 heraufzusetzen.
a) Die Beklagte hat die Klägerin wegen ihres Geschlechts jahrelang unmittelbar beim Entgelt benachteiligt und damit gegen das Verbot des § 7 Abs. 1 AGG iVm. § 1 AGG verstoßen. Die geringere Vergütung der Klägerin und einer Vielzahl weiterer weiblicher Produktionsbeschäftigten für gleiche oder gleichwertige Arbeit bis zum 31.12.2012 war nicht gerechtfertigt. Hierüber herrscht zwischen den Parteien kein Streit.
b)§ 15 Abs. 2 Satz 1 AGG räumt dem Gericht einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Höhe der Entschädigung ein.Bei der Höhe einer festzusetzenden Entschädigung ist zu berücksichtigen, dass sie nach § 15 Abs. 2 AGG angemessen sein muss. Sie muss einen tatsächlichen und wirksamen rechtlichen Schutz der aus dem Unionsrecht hergeleiteten Rechte gewährleisten. Die Härte der Sanktionen muss der Schwere des Verstoßes entsprechen, indem sie insb. eine wirklich abschreckende Wirkung gewährleistet, zugleich aber den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls – wie etwa die Art und Schwere der Benachteiligung, ihre Dauer und Folgen, der Anlass und der Beweggrund des Handelns – und der Sanktionszweck der Entschädigungsnorm zu berücksichtigen (vgl. ua. BAG 22.05.2014 – 8 AZR 662/13 – Rn. 44 mwN, Juris).
Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Berufungskammer unter Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles eine Entschädigung iHv. € 6.000,00 für angemessen. Die Beklagte hat die Klägerin und eine Vielzahl weiterer Frauen bis 31.12.2012 jahrelang bei gleicher Tätigkeit wegen ihres Geschlechts geringer vergütet als Männer. Art, Schwere und Dauer der vorliegenden Benachteiligung gebieten es einen fühlbaren Entschädigungsbetrag festzusetzen, denn es handelte sich um eine unmittelbare Benachteiligung, die schwerer wiegt als eine bloß mittelbare (vgl. BAG 18.3.2010 – 8 AZR 1044/08 – Rn. 43, NZA 2010, 1129). Ferner ist von einem vorsätzlichen und nicht nur fahrlässigen Verhalten der Beklagten bei der Benachteiligung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts auszugehen. Entgegen ihrer Ansicht vermag es die Beklagte nicht zu entlasten, dass die unterschiedliche Entlohnung von Frauen und Männern in ihrem Produktionsbetrieb nicht verdeckt erfolgt, sondern jederzeit „offen kommuniziert“ worden sei. Die geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung beim Entgelt, die die Beklagte bis 31.12.2012 fortgesetzt hat, war eklatant rechtswidrig. Dass die Ungleichbehandlung der Frauen nach dem Vorbringen der Beklagten in ihrem Betrieb offen zu Tage getreten sein soll, schmälert den Unwertgehalt der Diskriminierung nicht.
Die Höhe des Bruttomonatsentgelts der Klägerin ist für die Höhe der Entschädigung im Streitfall unerheblich. Das Bruttomonatsentgelt kann ein geeigneter Maßstab bei der Festlegung der Entschädigungshöhe im Zusammenhang mit Nichteinstellungen (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 2 AGG) oder Entlassungen (vgl. § 10 KSchG) sein. Die vorliegende Diskriminierung erfolgte jedoch im bestehenden Arbeitsverhältnis, so dass die Vergütungshöhe nicht zwingend Einfluss auf die Höhe der Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG haben muss (vgl. BAG 22.01.2009 – 8 AZR 906/07 – Rn. 84, AP AGG § 15 Nr. 1).
Nach der Wertung des Gesetzgebers stellen Benachteiligungen wegen des Geschlechts regelmäßig eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar (BAG 19.12.2013 – 6 AZR 190/12 – Rn. 38 mwN, NZA 2014, 372; KR/Treber 10. Aufl. § 15 AGG Rn. 27 mwN). Die Sanktion des § 15 Abs. 2 AGG soll im Kern gerade vor solchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen schützen. Die im diskriminierenden Verhalten liegende Persönlichkeitsrechtsverletzung soll als solche unabhängig von den materiellen Ansprüchen sanktioniert werden. Im vorliegenden Fall ist es sachgerecht, die Höhe der Entschädigung vom durchschnittlichen Bruttomonatsentgelt der Klägerin abzukoppeln. Die Beklagte hat in ihrem Betrieb alle weiblichen Produktionsbeschäftigten mit einfacher Tätigkeit jahrelang wegen ihres Geschlechts geringer vergütet als die männlichen. Wenn auch die Vergütungsdifferenzen, ua. wegen der Arbeitszeiten, für jede Frau unterschiedlich hoch ausfallen, ist doch die mit der geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlung verbundene Persönlichkeitsverletzung für jede im Produktionsbetrieb der Beklagten betroffene Frau gleich schlimm. Deshalb hält die Berufungskammer die Festsetzung eines einheitlichen Entschädigungsbetrags von € 6.000,00 für angemessen.
Eine interessante Entscheidung, die zeigt, dass der Arbeitgeber hier zweimal „bestraft“ wird. Zum einen muss er den Differenzlohn zahlen, zum anderen muss auch eine Entschädigung nach dem AGG gezahlt werden. Derartige Entschädigungsklagen nehmen immer mehr zu. Arbeitnehmer werden hier durch entsprechende Urteile, die in der Presse diskutiert werden, sensibilisiert. Nicht zu vergessen ist aber, dass sich derartige Benachteiligungen trotzdem immer noch für viele Arbeitgeber lohnen, da eben meist nur eine sehr geringe Anzahl von Arbeitnehmern tatsächlich ihre Ansprüche geltend machen.
RA A. Martin


