Diskriminierung
„Digital Native“ in einer Stellenausschreibung – Diskriminierung?
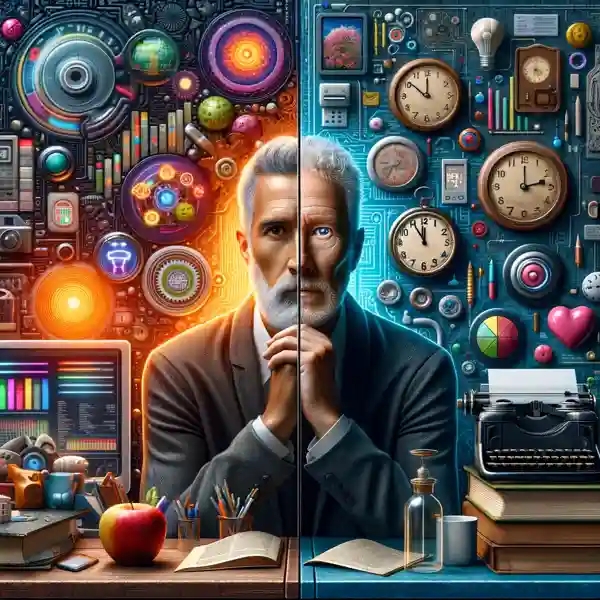
Stellenausschreibungen von Firmen im Internet oder über Zeitungen führen oft dazu, dass Personen, die abgelehnt werden, sich später an das Arbeitsgericht wenden und eine Entschädigung fordern.
AGG und Diskriminierung bei Stellenanzeigen
Die Ausschreibungen müssen korrekt sein und dies wird immer noch von vielen Firmen übersehen.
Neben der Frage, dass geschlechtsneutral Ausschreibungen zu erfolgen haben, ist auch zu beachten, dass keine bestimmten Personengruppen von vornherein ausgeschlossen werden.
AGG-Hopping
Hier passieren immer wieder Fehler, obwohl mittlerweile sich herumgesprochen hat, dass es Bewerber gibt, die sich nur bewerben, um später einen Entschädigungsanspruch geltend machen zu können. Dies nennt man AGG-Hopping.
Das Arbeitsgericht Heilbronn (Urteil vom 18. Januar 2024 -Aktenzeichen 8 Ca 191/23) hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Arbeitnehmer einen Entschädigungsanspruch gelten machen kann, wenn er sich beworben hatte und abgelehnt wurde auf eine Stellenausschreibung, in der mit „Digital Native“ geworben wurde.
Basierend auf dem Urteil des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 18. Januar 2024 (Aktenzeichen 8 Ca 191/23) bezüglich einer Entschädigung wegen Altersdiskriminierung bei einer Einstellung, lässt sich ein Artikel wie folgt strukturieren:
Digital Native
Der Fall drehte sich um die Verwendung des Begriffs „Digital Native“ in einer Stellenanzeige, der als Indiz für eine Altersdiskriminierung gewertet wurde. Dieses Urteil betont die Bedeutung eines bewussten und diskriminierungsfreien Sprachgebrauchs in Stellenausschreibungen. Dass dies nicht immer möglich ist, wissen aber Juristen.
Sachverhalt
Der Kläger, ein im Jahr 1972 geborener Diplomwirtschaftsjurist, bewarb sich im April 2023 auf eine von der Beklagten, einem international agierenden Handelsunternehmen im Bereich Sportartikel, ausgeschriebene Position als Manager Corporate Communication. Die beklagte „Arbeitgeberin“ hatte in ihrer Stellenausschreibung unter anderem formuliert, dass sich Bewerber als „Digital Native“ in der Welt der sozialen Medien und verwandten Technologien zu Hause fühlen sollten. Nachdem der Kläger eine Absage erhalten hatte, machte er einen Entschädigungsanspruch wegen Altersdiskriminierung geltend, da er der Ansicht war, die Formulierung „Digital Native“ ziele darauf ab, jüngere Bewerber zu bevorzugen. Der Kläger wollte hier eine Entschädigung von € 37.500 (5 Montatsgehälter a € 7.500)!
Entscheidungsgründe
Das Arbeitsgericht stellte fest, dass die Verwendung des Begriffs „Digital Native“ in der Tat ein Indiz für eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters darstellt. Insgesamt war die Ausschreibung so gehalten, dass diese sich vor allem an jüngere Bewerber richtete.
Arbeitsgericht Heilbronn
Die beklagte Firma konnte nicht widerlegen, dass andere Gründe als das Alter des Klägers zu dessen Benachteiligung geführt hatten. Dem Kläger wurde daher eine Entschädigung in Höhe von 7.500 Euro (zugesprochen, was 1, 5 Bruttomonatsgehältern – nach der Berechnung des Gerichts) entsprach. Das Gericht argumentierte, dass eine Entschädigung in dieser Höhe notwendig und angemessen sei, um den immateriellen Schaden des Klägers zu kompensieren und eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Ausführungen des Gerichts
Arbeitsgericht Heilbronn
Besteht die Vermutung einer Benachteiligung nach § 22 AGG, trägt die andere Partei die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt worden ist. Hierfür gilt allerdings das Beweismaß des sogenannten Vollbeweises. Der Arbeitgeber muss Tatsachen vortragen und gegebenenfalls beweisen, aus denen sich ergibt, dass ausschließlich andere als die in § 1 AGG genannten Gründe zu einer ungünstigeren Behandlung geführt haben (BAG 23. Januar 2020 – 8 AZR 484/18 – Rn. 36 mit weiteren Nachweisen). Es genügt also nicht der Nachweis, dass es nicht diskriminierende Gründe gibt, die die Differenzierung hätten rechtfertigen können, sondern nur der Nachweis, dass ausschließlich diese Kriterien im konkreten Fall verwendet wurden. Das kann etwa durch Offenlegung der Dokumentation des Ablaufs der benachteiligenden Entscheidung erfolgen, durch Berücksichtigung älterer Bewerber trotz an „junge“ gerichteter Ausschreibung im selben Besetzungsverfahren oder durch die Berücksichtigung anderer Merkmalsträger für die Teilnahme an der zweiten Stufe eines Auswahlverfahrens.
FAQ
Was versteht man unter Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess?
Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess liegt in der Regel vor, wenn ein Bewerber aufgrund seines Alters weniger günstig behandelt wird als andere Bewerber in einer vergleichbaren Situation. Dies kann sich in der Formulierung von Stellenausschreibungen, der Auswahl der Bewerber für Vorstellungsgespräche oder der endgültigen Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten manifestieren.
Wie kann ich erkennen, ob eine Stellenanzeige altersdiskriminierend ist?
Eine Stellenanzeige könnte als altersdiskriminierend angesehen werden, wenn sie Begriffe oder Formulierungen enthält, die eine Präferenz für Bewerber eines bestimmten Alters suggerieren, z.B. „junges dynamisches Team“ oder die explizite Suche nach „Digital Natives“. Solche Formulierungen können ältere Bewerber indirekt ausschließen.
Welche Beweislastregelungen gelten bei Verdacht auf Altersdiskriminierung?
Nach § 22 AGG trägt die Partei, die sich diskriminiert fühlt, die Beweislast dafür, Indizien vorzubringen, die auf eine Diskriminierung hindeuten. Kann diese Person solche Indizien glaubhaft machen, verschiebt sich die Beweislast auf den Arbeitgeber, der dann nachweisen muss, dass keine Diskriminierung vorliegt und die Entscheidung auf anderen, legitimen Gründen basiert.
Anmerkung:
Wenn man schon englische Begriffe in einer Bewerbung verwendet, sollte man auch verstehen, was dies (rechtlich) bedeutet. Viele Firmen bekommen die Stellenanzeigen noch nicht einmal auf Deutsch rechtlich sauber formuliert. Man sollte von daher mit allen Hinweisen in der Anzeige sehr vorsichtig umgehen, aus denen man schließen könnte, dass junge Bewerber bevorzugt werden. Dies war hier das Problem der Beklagten.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Was ist eine Entgeltgleichheitsklage?

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?
Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ für Männer und Frauen ergibt sich aus der sich aus Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 157 AEUV,Art. 1 RL 75/117/EWG und hat über Art. 23 GRCh auch eine grundrechtlichem Charakter. Dies betrifft ausdrücklich Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Auch schon aus dem AGG (Antidiskriminierungsgesetz) ergibt sich ein Verbot der Diskriminierung bei der Lohnzahlung aufgrund des Geschlechts. Seit dem Jahr 2017 gibt es darüber hinaus auch das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG).
Wo ist Lohnzahlungsgleichheit im Entgelttransparenzgesetz geregelt?
Nach § 7 des EntgTranspG darf bei Beschäftigungsverhältnissen für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts. Dieses Gesetz normiert nun erstmals seit 2017 konkret das Entgeltgleichheitsgebot und gibt den Arbeitnehmer auch einen entsprechenden Auskunftsanspruch gegen den Arbeitgeber.
Was ist verboten beim Lohn für Männer und Frauen?
Verboten ist eine unterschiedlich hohe Lohnzahlung aufgrund des Geschlechts für die gleiche oder gleichwertige Arbeit.
Was heißt gleiche Arbeit?
Gleiche Arbeit liegt vor, wenn Arbeitnehmer identische oder gleichartige Tätigkeiten ausüben. Dabei kommt es auf einen Gesamtvergleich der Tätigkeiten an. Dies kann manchmal schwierig sein, wenn mehrere Tätigkeiten ausgeführt werden. Hier hilft man sich so, dass es einzelnen Abweichungen jeweils auf die überwiegende Tätigkeit abgestellt wird.
Vorübergehender Einsatz oder Teileinsatz
Problematisch ist ein nur teilweiser und vorübergehender Einsatz in Bezug auf eine Tätigkeit, wie z.B. an denselben Maschinen. Dies rechtfertigt die Annahme gleicher Arbeit nicht, wenn die betreffenden Arbeitnehmer auch andere Tätigkeiten ausüben, für die sie nach dem Inhalt ihrer Arbeitsverträge eingestellt worden sind.
Was ist eine gleichwertige Arbeit?
Gleichwertige Arbeit liegt vor, wenn Arbeitnehmer Tätigkeiten ausüben, die nach objektiven Maßstäben der Arbeitsbewertung denselben Arbeitswert haben. Auch hier kommt es auf einen Gesamtvergleich der Tätigkeiten an. Zu berücksichtigen ist dabei auch der jeweils erforderliche Umfang von Vorkenntnissen und Fähigkeiten.
Wo ist das Problem?
Das Problem liegt vor allem darin, dass der Arbeitgeber grundsätzlich auch die männlichen Arbeitnehmer nicht komplett gleich bezahlen muss. Auch hier kann es Unterschiede geben, auch bei gleicher Tätigkeit (zB. auch wegen unterschiedliche Erfahrung etc). Von da es auf den ersten Blick auch nicht immer zu sehen, ob tatsächlich eine geringere Bezahlung einer Frau eine Diskriminierung darstellt.
Von daher bietet sich an dass gegebenfalls auch die Belegschaft insgesamt betrachtet wird. Zahlt der Arbeitgeber nämlich ein Großteil der männlichen Belegschaft einen höheren Lohn als in Tariflohn und bei den Frauen zum Beispiel nur ein Zehntel, dann liegt eine Diskriminierung nahe.
Wer muss die Benachteiligung beweisen?
Auch im Arbeitsgerichtsverfahren gilt der Grundsatz – welcher für den Zivilprozess entwickelt wurde – dass derjenige, der sich auf Tatsachen beruft, die Tatsachen darlegen und beweisen muss, welche für ihn günstig sind. Von daher müsste also die benachteiligte Frau auch ihre Benachteiligung/ Diskriminierung nachweisen.
Wann gibt es eine Umkehr der Beweislast?
Art. 22 des AGG kehrt die Beweislast um. Und zwar muss der Arbeitgeber dann die Tatsachen darlegen und beweisen, wenn die Vermutung einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts vorliegt.
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.
Welche Möglichkeiten der Auskunft hat die Arbeitnehmerin?
Das Entgelttransparenzgesetz sieht darüber hinaus einen Auskunftsanspruch des vermutlich benachteiligten Arbeitnehmers vor.
Was regelt § 10 des Entgelttransparenzgesetz?
§ 10 des EntgTranspG gibt der bzw. dem benachteiligen Arbeitnehmer ein Recht auf Auskunft gegenüber dem Arbeitgeber. Dieser Auskunftsanspruch dient der Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots im Sinne dieses Gesetzes. § 10 regelt:
(1) Zur Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots im Sinne dieses Gesetzes haben Beschäftigte einen Auskunftsanspruch nach Maßgabe der §§ 11 bis 16. Dazu haben die Beschäftigten in zumutbarer Weise eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit (Vergleichstätigkeit) zu benennen. Sie können Auskunft zu dem durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt nach § 5 Absatz 1 und zu bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandteilen verlangen.
(2) Das Auskunftsverlangen hat in Textform zu erfolgen. Vor Ablauf von zwei Jahren nach Einreichen des letzten Auskunftsverlangens können Beschäftigte nur dann erneut Auskunft verlangen, wenn sie darlegen, dass sich die Voraussetzungen wesentlich verändert haben.
(3) Das Auskunftsverlangen ist mit der Antwort nach Maßgabe der §§ 11 bis 16 erfüllt.
(4) Sonstige Auskunftsansprüche bleiben von diesem Gesetz unberührt.
Differenzierung zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Arbeitgebern
Das EntgTranspG differenziert zwischen tarifgebundenen Arbeitgebern (§ 5 Abs. 4 EntgTranspG) und Arbeitgebern, die nicht tarifgebunden sind. Durch das Gesetz erfolgt eine Privilegierung der tarifgebundenen Arbeitgeber, denn es wird im Gesetz vermutet, dass tarifliche Entgeltsysteme benachteiligungsfrei, was nicht völlig falsch ist.
Gibt es aktuelle Entscheidungen zu Entgeltgleichheitsklagen?
Es gibt hier schon Entscheidungen, insbesondere auch zur Entgeltgleichheitsklage nach dem EntgTranspG.
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 21. Januar 2021 – 8 AZR 488/19 -) hat dazu kürzlich im Januar 2021 entschieden, dass eine Vermutung der Benachteiligung einer Arbeitnehmerin bei der Entgeltzahlung vorliegt, wenn sich aus der Auskunft des Arbeitgebers zum Gehalt der vergleichbaren Arbeitnehmer (Median-Entgelt) eine Differenz zu Ungunsten der Arbeitnehmerin ergibt.
In der Pressemitteilung Nr. 1/21 vom 21.01.2021 führt das BAG dazu aus:
Die Revision der Klägerin hatte vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Mit der vom Landesarbeitsgericht gegebenen Begründung durfte die Klage nicht abgewiesen werden. Aus der von der Beklagten erteilten Auskunft ergibt sich das Vergleichsentgelt der maßgeblichen männlichen Vergleichsperson. Nach den Vorgaben des EntgTranspG liegt in der Angabe des Vergleichsentgelts als Median-Entgelt durch einen Arbeitgeber zugleich die Mitteilung der maßgeblichen Vergleichsperson, weil entweder ein konkreter oder ein hypothetischer Beschäftigter des anderen Geschlechts dieses Entgelt für gleiche bzw. gleichwertige Tätigkeit erhält. Die Klägerin hat gegenüber der ihr von der Beklagten mitgeteilten männlichen Vergleichsperson eine unmittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 2 Satz 1 EntgTranspG erfahren, denn ihr Entgelt war geringer als das der Vergleichsperson gezahlte. Entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts begründet dieser Umstand zugleich die – von der Beklagten widerlegbare – Vermutung, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung „wegen des Geschlechts“ erfahren hat. Aufgrund der bislang vom Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen konnte der Senat nicht entscheiden, ob die Beklagte, die insoweit die Darlegungs- und Beweislast trifft, diese Vermutung den Vorgaben von § 22 AGG in unionsrechtskonformer Auslegung entsprechend widerlegt hat. Zugleich ist den Parteien Gelegenheit zu weiterem Vorbringen zu geben. Dies führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht.
Anmerkung zur Entscheidung:
Der Arbeitgeber muss bei der Auskunft sehr sorgfältig sein. Ergibt sich aus seiner Auskunft ein geringes Einkommen der Arbeitnehmerin, dann wird deren Benachteiligung vermutet. Diese Vermutung muss der Arbeitgeber nun widerlegen, wenn er den Prozess noch gewinnen will.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht Berlin
BAG: Kopftuchverbot in Privatwirtschaft zulässig?
Die Entscheidungen zur Frage, ob ein Kopftuchverbot zulässig ist, reißen nicht ab. Nun hat das Bundesarbeitsgericht (Beschluss vom 30. Januar 2019 – 10 AZR 299/18 (A)) die Frage zu entscheiden, anders als zuvor, ob ein Verbot des Tragens des muslimischen Kopftuchs auch in der Privatwirtschaft (also nicht im öffentlichen Dienst) wirksam ist.
Sachverhalt
Die beklagte Arbeitgeberin ist ein Unternehmen des Einzelhandels. Dort ist die Arbeitnehmerin/ Klägerin als Verkaufsberaterin und Kassiererin beschäftigt und diese trug zunächst kein muslimisches Kopftuch. Als die Klägerin aus der Elternzeit zurückkehrte, trug diese dann – aus religiösen Gründen – ein Kopftuch.
Arbeitnehmerin legt Kopftuch nicht ab
Die beklagte Arbeitgeberin forderte – ohne Erfolg – die Klägerin auf das Kopftuch auf Arbeit abzulegen.
Kleiderordnung im Betrieb verbietet das Tragen von auffälligen religiösen Symbolen
Im Betrieb der Beklagten gibt es eine Kleiderordnung, nach welcher das Tragen auffälliger großflächiger religiöser, politischer und sonstiger weltanschaulicher Zeichen am Arbeitsplatz verboten ist.
Klage der muslimischen Arbeitnehmerin
Die muslimische Arbeitnehmerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die Weisung der Arbeitgeberin und möchte festgestellt wissen, dass diese unwirksam ist.
Religionsfreiheit vs unternehmerische Freiheit
Die Klägerin ist der Auffassung, die Weisung der Arbeitgeberin sei unwirksam, weil sie dadurch wegen ihrer Religion diskriminiert werde. Die beklagte Arbeitgeberin hingegen beruft sich auf ihre unternehmerische Freiheit und den Schutz der negativen Religionsfreiheit ihrer Kunden und übrigen Arbeitnehmer.
Vorinstanzen gaben der muslimischen Klägerin recht
Die Vorinstanzen (u.a. dasLandesarbeitsgericht Nürnberg, Urteil vom 27. März 2018 – 7 Sa 304/17) haben der Klage stattgegeben.
Bundesarbeitsgericht legt die Frage dem EuGH vor
Das Bundesarbeitsgericht (Beschluss vom 30. Januar 2019 – 10 AZR 299/18 ) führt dazu in seiner Pressemitteilung vom 30.1.2019 mit der Nr. 4/19aus:
Das Verbot eines Unternehmens der Privatwirtschaft, auffällige großflächige Zeichen religiöser, politischer und sonstiger weltanschaulicher Überzeugungen am Arbeits-platz zu tragen, wirft Fragen nach der Auslegung von Unionsrecht auf. Diese Fragen müssen im Zusammenhang mit Konventions- und Verfassungsrecht durch ein Vorabentscheidungsersuchen geklärt werden, das der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts an den Gerichtshof der Europäischen Union richtet.
Der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts ersucht den Gerichtshof der Europäischen Union, Fragen nach der Auslegung der Richtlinie 2000/78/EG und dem Verhältnis von primärem Unionsrecht und nationalem Verfassungsrecht zu beantworten. Ist eine allgemeine Anordnung in der Privatwirtschaft, die auch das Tragen auffälliger religiöser Zeichen verbietet, aufgrund der von Art. 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) geschützten unternehmerischen Freiheit diskriminierungsrechtlich stets gerechtfertigt? Oder kann die Religionsfreiheit der Arbeitnehmerin berücksichtigt werden, die von der GRC, der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und dem Grundgesetz geschützt wird?
Anmerkung:
Der EuGH hatte schon einmal ähnlich über die Frage der Einschränkung von religiösen Symbolen (auch hier Kopftuch) am Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft entschieden (EuGH- Urteil vom 14.März 2017 – C 188-15) .
Im hier oben genannten Fall ging es darum, dass eine Softwareentwicklerin bei einem französischen Unternehmen tätig war und das islamische Kopftuch trug. Ein Kunde beschwerte sich und der Arbeitgeber verlangte von der Arbeitnehmerin, dass sie zukünftig nicht mehr das Kopftuch tragen solle.Diese lehnte dies ab, worauf hin der französische Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit der Muslima durch Kündigung beendete. Dagegen wehrte sich die Arbeitnehmerin und das französische Gericht legte die Streitfrage dem EuGH vor.
Der EuGH entschied, dass es grundsätzlich zulässig sei, dass ein Unternehmen eine interne Regelung treffe, wonach (alle!) religiöse Symbole durch Arbeitnehmer während der Arbeit nicht getragen werden dürfen, so auch das islamische Kopftuch. Wenn es eine solche Regelung gibt, dann kann auch die Kündigung eines Arbeitnehmers, der dagegen verstößt, zulässig sein, wenn die Kündigung angemessen ist und mit ihr das Ziel verfolgt wird, dieses „Neutralitätsgebot“ in der Firma durchzusetzen.
Ich vermute, dass der EuGH hier ähnlich entscheiden wird.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kanzlei Marzahn -Hellersdorf in Berlin
Bundesverfassungsgericht: Abfindung nur für Mitglieder der Gewerkschaft ?
Abfindungen im Arbeitsrecht
Im Normalfall hat der gekündigte Arbeitnehmer keinen Abfindungsanspruch. Dies wissen aber viele Arbeitnehmer nicht, da gerade in den Medien der Eindruck vermittelt wird, dass jeder Arbeitnehmer, die eine Kündigung erhält, zumindest dann wenn die Kündigung betriebsbedingt ist, auch einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung hat. Dies ist aber nicht so.
Nachfolgend wird nun aber ein Fall dargestellt, bei den Arbeitnehmer tatsächlich einen Abfindungsanspruch haben.
Sachverhalt
In einem Sozialtarifvertrag war geregelt, dass bestimmte Überbrückungs- und Abfindungsleistungen nur Beschäftigten zu-kommen, die an einem vereinbarten Stichtag Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft waren.
Der Beschwerdeführer (Arbeitnehmer) erhielt die Leistungen nicht, da er keiner Gewerkschaft angehörte (teilweise aber aus dem Arbeitsvertrag), wogegen er klagte; bis zum Bundesverfassungsgericht ….
Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
Letztendlich verlor der Arbeitnehmer auch beim BVerfG (Beschluss vom 14. November 2018 – Az 1 BvR 1278/16). Das Bundesverfassungsgericht führt in seiner Pressemitteilung Nr. 89/2018 vom 21. Dezember 2018 folgendes dazu aus:
Eine unterschiedliche Behandlung gewerkschaftlich organisierter und nicht gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Tarifvertrag verletzt nicht die negative Koalitionsfreiheit, solange sich daraus nur ein faktischer Anreiz zum Gewerkschaftsbeitritt ergibt, aber weder Zwang noch Druck entsteht. Mit dieser Begründung hat die 2. Kammer des Ersten Senates mit heute veröffentlichtem Beschluss die Verfassungsbeschwerde eines gewerkschaftlich nicht organisierten Beschäftigten nicht zur Entscheidung angenommen, der sich durch eine sogenannte „Differenzierungsklausel“ in einem Tarifvertrag benachteiligt sah.
1.Art. 9 Abs. 3 GG schützt auch die Freiheit, Vereinigungen zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen fernzubleiben. Daher darf kein Zwang oder Druck in Richtung auf eine Mitgliedschaft ausgeübt werden. Die Tatsache, dass organisierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anders behandelt werden als nicht organisierte Beschäftigte, bedeutet insofern jedoch noch keine Grundrechtsverletzung, solange sich daraus nur ein eventueller faktischer Anreiz zum Beitritt ergibt, aber weder Zwang noch Druck entsteht. Hier behauptet der Beschwerdeführer zwar, es gebe einen „generalpräventiven“ Druck, einer Gewerkschaft beizutreten. Das wird aber nicht weiter belegt, eine individuelle Zwangswirkung ist nicht erkennbar. Das Bundesarbeitsgericht geht jedenfalls nachvollziehbar davon aus, dass kein höherer Druck erzeugt wird als derjenige, der sich stets ergibt, wenn individualvertragliche Vereinbarungen hinter den Abreden zurückbleiben, die eine Gewerkschaft im Wege eines Tarifvertrages nur für ihre Mitglieder treffen kann.
2.Es ist nicht erkennbar, dass das Grundrecht des Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1 GG, einen Arbeitsvertrag frei zu schließen und daher auch aushandeln zu können, verletzt wäre.
Abhängig Beschäftigte befinden sich beim Abschluss von Arbeitsverträgen typischerweise in einer Situation struktureller Unterlegenheit, weshalb Vorkehrungen zu treffen sind, um sie zu schützen. Schutz davor, dass eine Unterlegenheit ausgenutzt wird, können Tarifverträge bewirken, und grundsätzlich darf davon ausgegangen werden, dass von den Tarifvertragsparteien erzielte Verhandlungsergebnisse die Interessen beider Seiten sachgerecht zum Ausgleich bringen. Das hat das Bundesarbeitsgericht hier nachvollziehbar angenommen. Die betrieblichen und tarifvertraglichen Regelungen, die auch auf den Beschwerdeführer Anwendung fanden, waren angesichts der besonderen Umstände des Falles geeignet, eine strukturelle Unterlegenheit aufzufangen. Es fehlen jedenfalls Anhaltspunkte dafür, dass grundrechtliche Schutzinteressen des Beschwerdeführers verletzt worden wären, die einer Anwendung tarifvertraglicher Sonderregelungen für vor dem Stichtag eingetretene Mitglieder der Gewerkschaft entgegenstünden. Das Bundesarbeitsgericht hat das geprüft und die Differenzierung nach dem Zeitpunkt der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft an einem Stichtag für sachlich begründet erachtet. Sie hebe auf den besonderen Kündigungsschutz derjenigen ab, die gerade zuvor bereits Mitglied waren, weshalb ein Stichtag erforderlich war, um verlässlich zu bestimmen, wer die vereinbarten Leistungen erhalten würde. Zudem ist die Gewerkschaft ohnehin nur befugt, Abreden für ihre Mitglieder zu treffen, und kann schon aufgrund der Tarifautonomie nicht als verpflichtet angesehen werden, dabei alle Beschäftigten gleichermaßen zu berücksichtigen.
Es liegt auch kein Grund vor, generell anzunehmen, dass Sozialplanvolumina durch eigenständige tarifvertragliche Vereinbarungen zugunsten von Mitgliedern der Gewerkschaften und zulasten der Nichtorganisierten ausgezehrt werden. Hier war das Zustandekommen des Betriebsänderungsmodells insgesamt davon abhängig, dass der ganz überwiegende Teil der vom Ausscheiden betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diesem Modell selbst zustimmten. In Anbetracht des Organisationsgrades der Gewerkschaft war dies wiederum nur erreichbar, wenn auch die betroffenen Beschäftigten, die nicht Mitglied der Gewerkschaft waren, mehrheitlich ihre Zustimmung zu den Abreden erklärten. Zudem erreichen die auf bisherige Mitglieder der Gewerkschaft beschränkten Vergünstigungen kein Ausmaß, das angesichts des Gesamtvolumens der vereinbarten Leistungen eine Auszehrung nahelegen würde.
Bei gleicher Arbeit auch gleiches Geld ab 2017?
Das Bundeskabinett hat Mitte Januar 2017 das „Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen“ beschlossen. Dieses Gesetz soll gewährleisten, dass Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern bei gleicher Arbeit besteht. Angeblich sollen Frauen im Durchschnitt 21 % weniger Gehalt als Männer bei gleiche Tätigkeit erhalten.
Lohngleichheit – nicht zwischen allen Arbeitnehmern
Wichtig ist, dass dieses Gesetz speziell das Problem der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern regulieren soll und nicht die ungleiche Bezahlung generell für gleiche Arbeit. Denn bezahlt der Arbeitgeber den Frauen weniger – für die gleiche Arbeit – wie den Männern, dann liegt darin eine Ungleichbehandlung, die nach dem AGG (allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) schon jetzt eine nicht zulässige Diskriminierung darstellen könnte.
Problem war bisher der fehlende Auskunftsanspruch
Das Problem war bisher, dass die ungleiche Bezahlung der Frauen im Betrieb eine Diskriminierung (aufgrund des Geschlechts) darstellen konnte, aber die Frauen meist kaum Informationen hatten, wie viel ihre männlichen Kollegen im Betrieb erhalten haben. Dies soll sich nun in größeren Betrieben durch einen Auskunftsanspruch verbessern.
Auskunftsanspruch auch für männliche Arbeitnehmer im Betrieb
Den Anspruch auf Auskunft haben nicht nur die Frauen im Betrieb, sondern auch die Männer, ansonsten wäre dies eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung.
Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen
Der Gesetzentwurf sieht nun folgende Maßnahmen vor:
Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer im Betrieb von mehr als 200 Arbeitnehmern
- gegenüber Arbeitgeber über das Arbeitsentgelt von 6 vergleichbaren Arbeitnehmern des anderen Geschlechts
- nebst weitere Entgeltbestandteile, wie Boni oder Dienstwagen,
- Auskunftsanspruch in Betrieben ohne Betriebsrat und ohne Tarifvertrag direkt gegenüber dem Arbeitgeber
- in tarifgebundenen Unternehmen soll der Auskunftsanspruch in der Regel über den Betriebsrat erfolgen
- Arbeitgeber mit mehr als 500 Arbeitnehmern sollen regelmäßig alle 4 Jahre Berichte über den Stand der Entgeltgleichheit vorlegen.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Arbeitsgericht Köln: „Frauen an die Macht!“
Ein Autohaus wollte neue Mitarbeiter einstellen und hatte eine Stellenanzeige veröffentlicht.
Überschrieben war die Anzeige mit „Frauen an die Macht!!“. Das Autohaus suchte eine Verkäuferin und
stellte später auch eine Verkäuferin ein.
Der Kläger, ein Mann der sich ebenfalls auf die Stelle beworben hatte, fühlte sich wegen seines
Geschlechtes benachteiligt und machte gegen das Autohaus wegen Diskriminierung aufgrund seines
Geschlechtes eine Entschädigungsklage nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vor dem
Arbeitsgericht Köln geltend.
Das Arbeitsgericht Köln (Urteil vom 10.02.2016, Az. 9 Ca 4843/15) sah zwar in der Stellenanzeige eine
Benachteiligung des Klägers, allerdings keine Diskriminierung.
Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Köln verstößt die Stellenanzeige zwar gegen das Verbot der
Benachteiligung des Geschlechtes aus § 1 AGG, allerdings war eine solche
Benachteiligung/Schlechterstellung männlicher Bewerber ausnahmsweise zulässig, da der Arbeitgeber
das legitime Ziel verfolgte seinen Kunden Verkaufsberater beiderlei Geschlecht zur Verfügung zu
stellen.
Im Betrieb des beklagten Autohauses waren nämlich überwiegend Männer als Verkäufer tätig und
diverse Kunden (gerade weibliche Kunden) hatten häufiger nachgefragt, ob es dort nicht
Verkäuferinnen geben würde. Die weiblichen Kunden machten im Autohaus ungefähr 25% bis 30%
Anteil der potentiellen Käufer aus.
Da eben Verkäuferinnen häufiger von den Kundinnen nachgefragt wurden, bestand ein legitimes
Interesse des Autohauses an der Einstellung einer Kundenberaterin.
Rechtsanwalt Martin
LAG Berlin-Brandenburg: zweifache Kündigung einer Schwangeren führt zu Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung!
Ein Kollege (Anwalt) kündigte zunächst seine schwangeren Sekretärin ohne Kenntnis von deren Schwangerschaft. Diese informierte den Rechtsanwalt und die Arbeitnehmerin gewann das Kündigungsschutzverfahren. Einige Monate später kündigte der Anwalt erneut ohne Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde. Zu diesem Zeitpunkt wusste er aber bereits von der Schwangerschaft.
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom 16.09.2015, Aktenzeichen 23 Sa 1045/15) bestätigte nun im Berufungsverfahren das Urteil des Arbeitsgerichts und führte aus (in der Pressemitteilung):
Durch die erneute Kündigung wurde die Klägerin nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts wegen ihres Geschlechts benachteiligt. Der Einwand des Arbeitgebers, er habe angenommen, die Schwangerschaft sei bereits beendet, hat das Gericht für unberechtigt gehalten. Es hätten keine Anhaltspunkte für ein Ende der Schwangerschaft vorgelegen; auch sei die Klägerin nicht verpflichtet gewesen, den Arbeitgeber stets von dem Fortbestand der Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an das Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.
Anmerkung:
Die Besonderheit des Falles besteht darin, dass der Anwalt zweimal das Arbeitsverhältnis mit seiner schwangeren Arbeitnehmerin beenden wollte. Beim ersten Mal wusste er nicht, dass diese schwanger ist und von daher liegt auch keine bewusste Diskriminierung vor. Bei der zweiten Kündigung wusste er dies aber und von daher wurde eine Diskriminierung angenommen und der Anwalt muss sich hier eine Entschädigung zahlen.
Rechtsanwalt Andreas Martin
LAG Hessen: Bewerber sollen „Deutsch als Muttersprache“ beherrschen – Diskriminierung.
Ein Arbeitgeber schrieb eine befristete Stelle als Bürokraft aus und betonte in der Stellenanzeige, dass Bewerber „Deutsch als Muttersprache“ beherrschen müssten.
Ein aus Russland stammender Bewerber, der eben nicht Deutsch als Muttersprache sprach, aber sehr gute Deutschkenntnisse hatte und von daher für die Stelle geeignet war, bewarb sich, wurde aber nicht eingestellt. Eine Ablehnung erhielt er nicht; erfuhr aber später von der Besetzung der Stelle durch einen anderen Bewerber.
Der russische Arbeitnehmer meinte, dass er aufgrund seiner ethnischen Herkunft benachteiligt und diskriminiert worden sei, da er eben kein deutscher Muttersprachler sei.
Er klagte vor dem Arbeitsgericht auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Die Berufung zum LAG Hessen (Urteil vom 15.6.2015, 16 Sa 1619/14) hatte Erfolg. Das Landesarbeitsgericht Hessen verurteilte den „Arbeitgeber“ zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 2 Monatsgehältern. Die Entscheidung ist aber nicht rechtskräftig, da noch die Revision zum BAG läuft.
Das LAG betonte, dass die ausschreibende Firma (Arbeitgeber) den russischen Bewerber wegen seiner Ethnie nach § 1 AGG benachteiligt habe. Der Bewerber werde wegen seine Nichtzugehörigkeit zur deutschen Ethnie unabhängig von seinen tatsächlichen Sprachkenntnisse von vornherein ausgeschlossen. Ein sachlicher Grund für eine solche Benachteiligung ist nicht ersichtlich. Auch ein sehr gut Deutsch sprechender Ausländer hätte hier die fachlichen Voraussetzungen für die Stelle vorweisen können.
Rechtsanwalt Andreas Martin
LAG R-P: Frauen haben Anspruch auf Entschädigung bei geringerer Bezahlung als männliche Kollegen
Wer weiblichen Angestellten für die gleiche Arbeit weniger Geld bezahlt als den männlichen oder umgekehrt, diskriminiert die jeweilige Gruppe aufgrund ihres Geschlechts und muss die Lohndifferenz nachzahlen und im schlimmsten Fall auch nach Entschädigung nach dem AGG zahlen.
Die Klägerin – eine Frau- ist seit 01.07.1996 bei der Beklagten als einfache Produktionsmitarbeiterin beschäftigt. Die Beklagte, eine Schuhherstellerin, beschäftigt rund 170 Arbeitnehmer. Die Beklagte zahlte bis zum 31.12.2012 an die in der Produktion beschäftigten Frauen bei gleicher Tätigkeit einen geringeren Stundenlohn als den Männern.
|
Die Beklagte zahlte |
der Klägerin |
vergleichbaren |
Differenz |
|
2009 |
€ 8,54 |
€ 9,76 |
€ 1,22 |
|
2010, 2011, 2012 |
€ 8,72 |
€ 9,86 |
€ 1,14 |
Aufgrund der Ungleichbehandlung verklagte die Arbeitnehmerin den Arbeitgeber auf rückständigen Lohn iHv. € 12.156,88 brutto sowie – weiter- ihr wegen Verstoßes gegen das AGG eine angemessene Entschädigung nach dem AGG zu zahlen, die sich jedoch auf mindestens € 9.194,50 belaufen sollte.
Das Arbeitsgericht Koblenz verurteilte den Arbeitgeber rückständigen Arbeitslohn in Höhe von € 7.543,57 brutto und eine Entschädigung in Höhe von iHv. € 3.537,18 zu zahlen.
Gegen das Urteil der ersten Instanz legten beide Parteien Berufung zum Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz ein.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 14.8.2014 – 5 Sa 509/13) kam zu keinem höheren Lohnanspruch, wie die ersten Instanz, aber erhöhte die Entschädigung auf EUR 6.000 und führte dazu aus:
2. Das Arbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass der Klägerin ein Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG zusteht, weil sie von der Beklagten wegen ihres Geschlechts beim Entgelt benachteiligt worden ist. Auf die Berufung der Klägerin ist der vom Arbeitsgericht festgesetzte Entschädigungsbetrag auf € 6.000,00 heraufzusetzen.
a) Die Beklagte hat die Klägerin wegen ihres Geschlechts jahrelang unmittelbar beim Entgelt benachteiligt und damit gegen das Verbot des § 7 Abs. 1 AGG iVm. § 1 AGG verstoßen. Die geringere Vergütung der Klägerin und einer Vielzahl weiterer weiblicher Produktionsbeschäftigten für gleiche oder gleichwertige Arbeit bis zum 31.12.2012 war nicht gerechtfertigt. Hierüber herrscht zwischen den Parteien kein Streit.
b)§ 15 Abs. 2 Satz 1 AGG räumt dem Gericht einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Höhe der Entschädigung ein.Bei der Höhe einer festzusetzenden Entschädigung ist zu berücksichtigen, dass sie nach § 15 Abs. 2 AGG angemessen sein muss. Sie muss einen tatsächlichen und wirksamen rechtlichen Schutz der aus dem Unionsrecht hergeleiteten Rechte gewährleisten. Die Härte der Sanktionen muss der Schwere des Verstoßes entsprechen, indem sie insb. eine wirklich abschreckende Wirkung gewährleistet, zugleich aber den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls – wie etwa die Art und Schwere der Benachteiligung, ihre Dauer und Folgen, der Anlass und der Beweggrund des Handelns – und der Sanktionszweck der Entschädigungsnorm zu berücksichtigen (vgl. ua. BAG 22.05.2014 – 8 AZR 662/13 – Rn. 44 mwN, Juris).
Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Berufungskammer unter Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles eine Entschädigung iHv. € 6.000,00 für angemessen. Die Beklagte hat die Klägerin und eine Vielzahl weiterer Frauen bis 31.12.2012 jahrelang bei gleicher Tätigkeit wegen ihres Geschlechts geringer vergütet als Männer. Art, Schwere und Dauer der vorliegenden Benachteiligung gebieten es einen fühlbaren Entschädigungsbetrag festzusetzen, denn es handelte sich um eine unmittelbare Benachteiligung, die schwerer wiegt als eine bloß mittelbare (vgl. BAG 18.3.2010 – 8 AZR 1044/08 – Rn. 43, NZA 2010, 1129). Ferner ist von einem vorsätzlichen und nicht nur fahrlässigen Verhalten der Beklagten bei der Benachteiligung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts auszugehen. Entgegen ihrer Ansicht vermag es die Beklagte nicht zu entlasten, dass die unterschiedliche Entlohnung von Frauen und Männern in ihrem Produktionsbetrieb nicht verdeckt erfolgt, sondern jederzeit „offen kommuniziert“ worden sei. Die geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung beim Entgelt, die die Beklagte bis 31.12.2012 fortgesetzt hat, war eklatant rechtswidrig. Dass die Ungleichbehandlung der Frauen nach dem Vorbringen der Beklagten in ihrem Betrieb offen zu Tage getreten sein soll, schmälert den Unwertgehalt der Diskriminierung nicht.
Die Höhe des Bruttomonatsentgelts der Klägerin ist für die Höhe der Entschädigung im Streitfall unerheblich. Das Bruttomonatsentgelt kann ein geeigneter Maßstab bei der Festlegung der Entschädigungshöhe im Zusammenhang mit Nichteinstellungen (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 2 AGG) oder Entlassungen (vgl. § 10 KSchG) sein. Die vorliegende Diskriminierung erfolgte jedoch im bestehenden Arbeitsverhältnis, so dass die Vergütungshöhe nicht zwingend Einfluss auf die Höhe der Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG haben muss (vgl. BAG 22.01.2009 – 8 AZR 906/07 – Rn. 84, AP AGG § 15 Nr. 1).
Nach der Wertung des Gesetzgebers stellen Benachteiligungen wegen des Geschlechts regelmäßig eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar (BAG 19.12.2013 – 6 AZR 190/12 – Rn. 38 mwN, NZA 2014, 372; KR/Treber 10. Aufl. § 15 AGG Rn. 27 mwN). Die Sanktion des § 15 Abs. 2 AGG soll im Kern gerade vor solchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen schützen. Die im diskriminierenden Verhalten liegende Persönlichkeitsrechtsverletzung soll als solche unabhängig von den materiellen Ansprüchen sanktioniert werden. Im vorliegenden Fall ist es sachgerecht, die Höhe der Entschädigung vom durchschnittlichen Bruttomonatsentgelt der Klägerin abzukoppeln. Die Beklagte hat in ihrem Betrieb alle weiblichen Produktionsbeschäftigten mit einfacher Tätigkeit jahrelang wegen ihres Geschlechts geringer vergütet als die männlichen. Wenn auch die Vergütungsdifferenzen, ua. wegen der Arbeitszeiten, für jede Frau unterschiedlich hoch ausfallen, ist doch die mit der geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlung verbundene Persönlichkeitsverletzung für jede im Produktionsbetrieb der Beklagten betroffene Frau gleich schlimm. Deshalb hält die Berufungskammer die Festsetzung eines einheitlichen Entschädigungsbetrags von € 6.000,00 für angemessen.
Eine interessante Entscheidung, die zeigt, dass der Arbeitgeber hier zweimal „bestraft“ wird. Zum einen muss er den Differenzlohn zahlen, zum anderen muss auch eine Entschädigung nach dem AGG gezahlt werden. Derartige Entschädigungsklagen nehmen immer mehr zu. Arbeitnehmer werden hier durch entsprechende Urteile, die in der Presse diskutiert werden, sensibilisiert. Nicht zu vergessen ist aber, dass sich derartige Benachteiligungen trotzdem immer noch für viele Arbeitgeber lohnen, da eben meist nur eine sehr geringe Anzahl von Arbeitnehmern tatsächlich ihre Ansprüche geltend machen.
RA A. Martin
BAG: Zusatzurlaub für ältere Arbeitnehmer zulässig
Das Bundesarbeitsgericht hat gestern entschieden, dass eine Regelung, wonach Arbeitnehmer nach Vollendung des 58 Lebensjahres zusätzlichen Urlaub erhalten, zulässig ist.
Die nicht tarifgebundene Beklagte stellt Schuhe her. Sie gewährt ihren in der Schuhproduktion tätigen Arbeitnehmern nach Vollendung des 58. Lebensjahres jährlich 36 Arbeitstage Erholungsurlaub und damit zwei Urlaubstage mehr als den jüngeren Arbeitnehmern. Die 1960 geborene Klägerin hat gemeint, die Urlaubsregelung sei altersdiskriminierend. Die Beklagte habe deshalb auch ihr jährlich 36 Urlaubstage zu gewähren.
Die Arbeitnehmerin verlor in allen Instanzen mit ihrer Klage auf Feststellung, dass auch ihr 36 Arbeitstage an Erholungsurlaub zustehen würden.
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 21. Oktober 2014 – 9 AZR 956/12)
sah die Regelung als wirksam an und führte in der Pressemitteilung aus:
Die Beklagte hat mit ihrer Einschätzung, die in ihrem Produktionsbetrieb bei der Fertigung von Schuhen körperlich ermüdende und schwere Arbeit leistenden Arbeitnehmer bedürften nach Vollendung ihres 58. Lebensjahres längerer Erholungszeiten als jüngere Arbeitnehmer, ihren Gestaltungs- und Ermessensspielraum nicht überschritten. Dies gilt auch für ihre Annahme, zwei weitere Urlaubstage seien aufgrund des erhöhten Erholungsbedürfnisses angemessen, zumal auch der Manteltarifvertrag der Schuhindustrie vom 23. April 1997, der mangels Tarifbindung der Parteien keine Anwendung fand, zwei zusätzliche Urlaubstage ab dem 58. Lebensjahr vorsah.
Weiter führte das BAG (Pressemitteilung) aus:
Bei der Prüfung, ob eine solche vom Arbeitgeber freiwillig begründete Urlaubsregelung dem Schutz älterer Beschäftigter dient und geeignet, erforderlich und angemessen im Sinne von § 10 Satz 2 AGG ist, steht dem Arbeitgeber eine auf die konkrete Situation in seinem Unternehmen bezogene Einschätzungsprärogative zu.
Die Entscheidung ist auf den ersten Blick erstaunlich. Die Grenze von 58 Jahren erscheint willkürlich gewählt. Auch stellt sich die Frage, ob die 2 Tage Sonderurlaub tatsächlich die erhöhten Urlaubsbedürfnisse älterer Arbeitnehmer zu gewährleisten. Sachgerechter wäre hier eine kontinuierliche Steigerung des Urlaubsanspruches. Allerdings steht – so das BAG – dem Arbeitgeber auch hier ein Ermessensspielraum zu. Der Arbeitgeber muss sich also nicht immer für die sachgerechteste Lösung entscheiden.
RA A. Martin

